Hydraulischer Abgleich in zentralen Heizungsanlagen
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
Diese Methode ist auch für Bestandsanlagen sinnvoll, insbesondere, wenn einzelne Räume trotz voll aufgedrehter Heizkörperthermostate nicht warm werden. Denn das weist auf eine ineffizient laufende Heizungsanlage hin, durch die höhere Kosten und eine höhere Umweltbelastung entstehen.
Einordnung
Um jeden Raum in einem Gebäude gleichmäßig und effizient beheizen zu können, muss der Wasserdurchfluss in jedem Heizkörper und Heizkreis reguliert werden. Dies geschieht mittels eines hydraulischen Abgleichs. Dadurch wird nicht nur eine bessere Wärmeverteilung erreicht, sondern es wird zudem Energie gespart, da durch verbesserte Verteilung des Warmwassers die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann. Auf diese Weise können Energiekosten mitunter deutlich reduziert werden und der CO2-Ausstoß bei fossil betriebenen Heizungen verringert sich.
Umsetzung
Da für den hydraulischen Abgleich einige Berechnungen und Messungen durchgeführt werden müssen, wird die Unterstützung einer Fachfirma empfohlen, die ihr Fachwissen sowie die benötigten Messgeräte bereitstellt. Wird eine Wärmepumpe eingebaut, ist ein hydraulischer Abgleich immer notwendig, da in der Regel die bisherige Systemtemperatur abgesenkt wird.
Bevor der hydraulische Abgleich durchgeführt werden kann, muss zunächst die Heizlast bestimmt werden. Dazu wird der Wärmebedarf ermittelt, die Temperaturdifferenz zur maximalen Außentemperatur sowie die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage berücksichtigt und die Anlage auf Funktionsfähigkeit geprüft. Anschließend werden die hydraulischen Daten ermittelt. Hierzu zählen die Durchflussmenge, Vor- und Rücklauftemperatur, Druckverluste, sowie der Pumpendruck.
Nach Erhebung dieser Daten kann der hydraulische Abgleich durchgeführt werden. Dazu wird jeder Heizkörper auf einen bestimmten Heizwasser-Durchfluss eingestellt. Bei einer bestimmten Vorlauftemperatur als Arbeitspunkt der Heizungsanlage soll jeder Raum mit der Wärmemenge versorgt werden, die erforderlich ist, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Der Rücklauf jedes Heizkörpers muss dabei jeweils annähernd die gleiche Temperatur aufweisen.
In der Realität werden Räume jedoch häufig mit einem unterschiedlichen Warmwasserdurchfluss versorgt, weshalb Heizkörper, die sich weiter entfernt von der Heizungsanlage befinden, oft auch weniger warm werden (siehe im Bild links). Dies sorgt, je nach Ausprägung, für einen erhöhten Brennstoffverbrauch. Durch den hydraulischen Abgleich kann daher verbrauchs- wie auch kostenseitig häufig eine Einsparung von bis zu 15 Prozent erreicht werden.
Vor Abschluss der Tätigkeiten sollte eine Prüfung aller Einstellungen und Heizkörper vorgenommen werden, damit gegebenenfalls nachjustiert werden kann.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Insbesondere bei großen und komplexen Anlagen kann ein manueller Abgleich aller Heizkörper und -kreise einen unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand bedeuten. Je nach Gebäudestruktur können Heizkörper und Heizungsrohre außerdem schwer zugänglich sein. Auch eine mangelnde Datenlage erschwert die Umsetzung, insbesondere bei älteren Anlagen. Manche Heizkörper besitzen zudem keine voreinstellbaren Ventile, sodass diese für den hydraulischen Abgleich erst installiert werden müssen. Eine Fachfirma kann bei den meisten Problemen Abhilfe schaffen. Neben der Zugänglichkeit der Heizkörper sollte als wichtige Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich auch darauf geachtet werden, dass die Heizkörper die Wärme effizient an den Raum abgeben können.
Co-Benefits
Durch einen hydraulischen Abgleich kann die gesamte Heizungsanlage entlastet werden. Dadurch sind auch eine längere Lebensdauer und geringere Kosten für Instandsetzungen zu erwarten.
Fördermöglichkeiten
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz für Bestands- und Neubaugebäude. Sie gilt für Nichtwohngebäude, Wohngebäude und Einzelmaßnahmen. Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich sind im Rahmen des Fördergegenstands der Heizungsoptimierung der Einzelmaßnahmen förderfähig (für Nichtwohngebäude mit einer beheizten Fläche bis 1.000 m²). Zudem ist der hydraulische Abgleich für die Förderfähigkeit einiger anderer Energieeffizienzmaßnahmen sogar eine technische Mindestanforderung und somit auch in diesen Fällen förderfähig.
Weitere Hinweise
Die 2022 in Kraft getretene EnSimiMaV verpflichtet unter definierten Voraussetzungen Unternehmen dazu, bis zum 30. September 2023 einen hydraulischen Abgleich bei Gaszentralheizungssystemen durchzuführen. Dies gilt für Nichtwohngebäude mit einer beheizten Fläche über 1.000 m². Unternehmen sollten in jedem Fall prüfen, ob erforderliche Abgleiche erfolgt sind und dieses gegebenenfalls zeitnah nachholen.
Praxisbeispiel
Hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage in einem Bürogebäude
Ein Bürogebäude wird mit einer zentralen Gasheizung beheizt und benötigt circa 50.000 kWh Erdgas pro Jahr, um die benötigte Wärmeleistung bereitzustellen. Nach vermehrten Beschwerden, dass Büros in den oberen Stockwerken nicht mehr ausreichend warm werden, soll ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden.
Dazu wird eine Fachfirma beauftragt. Diese bestimmt die Heizlast, ermittelt alle notwendigen hydraulischen Daten, führt den Abgleich durch und überprüft die Ergebnisse. Durch den hydraulischen Abgleich reduziert sich die jährlich verbrauchte Menge Energie um rund 10 Prozent und somit 5.000 kWh, wodurch eine Kosteneinsparung von 655 €/ a erzielt wird.
| Unternehmensgröße | mittel |
| Investitionssumme | 1.200 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | - |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 5.000 kWh |
| CO2-Einsparung/ a | 1.010 kg |
| Kosteneinsparung | 655 €/ a |
| Amortisationszeit | 1,8 a |
| Kapitalwert | 4.387 € |
| Nutzungsdauer | 5 Jahre |
- Größe: 594 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
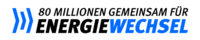
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Auszug aus einer Publikation des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Beitrag von Heiko Reckert, Senior Referent Energie- und Klimaschutzpolitik beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V., zu den neuen Anforderungen aus GEG und EPBD (27.2.2024).
Beitrag von Eckard von Schwerin, Key Account Manager bei der KfW,, zu den Förderprogrammen der KfW-Bank zur Steigerung von Energie und Senkung von CO2-Emissionen im Gebäudebereich. (13.2.2024)
Seit dem 1. Januar 2024 müssen neu eingebaute Heizungsanlagen im Grundsatz einen Anteil von 65 % erneuerbare Energien vorweisen. Es sind vielfältige Übergangsfristen vorgesehen.
Die Verordnung "zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" gilt seit dem 1. Oktober 2022.
Der Leitfaden soll es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der Logistik Anregungen für Optimierungspotenziale bieten.
