Einsatz von Wärmepumpen
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
0-9 / 10-19 / 20-249 / 250-499
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Organisatorisch
Beschreibung
In der chemischen und pharmazeutischen Industrie ebenso wie in allen Industriezweigen mit Beschichtungs-, Lackier- und Reinigungsprozessen bietet die Behandlung lösemittelhaltiger Abluft beträchtliche Potenziale für die Einsparung von Energie und CO2. Durch den Einsatz von Wärmepumpen zur Bereitstellung der Wärme sowie Kälte für das Verfahren der Kondensation mit vorgeschalteter Adsorption lassen sich besonders hohe Einsparpotenziale heben.
Einordnung
Zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) muss bei Anlagen der Beschichtungs-, Lackier- und Reinigungsindustrie die lösemittelhaltige Abluft nachbehandelt werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass primäre Maßnahmen zur Reduktion und Vermeidung von VOC bereits umgesetzt wurden. Der aktuelle Standard für die Abluftreinigung ist die thermische Nachverbrennung, die jedoch hohe CO2-Emissionen verursacht. Emissionsärmere Alternativen sind die Adsorption mit anschließender Kondensation, die biologische Oxidation, die Fotooxidation sowie die katalytische Nachverbrennung. Bei der Adsorption wird ein Abgasstrom über einen Stoff mit einer hohen reaktiven Oberfläche geleitet, um die Schadstoffe an diesem Stoff anzureichern. Häufig wird hierfür Aktivkohle eingesetzt.
Bei der Kondensation wird das Gas abgekühlt mit dem Ziel, das abzutrennende Gas zu verflüssigen, während die restlichen Bestandteile im Abgas gasförmig bleiben. Auf diese Weise können bestimmte Stoffe im Gas, zum Beispiel Lösungsmittel, gezielt abgeschieden werden. Bei der Behandlung von lösungsmittelhaltiger Abluft ist somit eine Rückführung der Lösungsmittel möglich. Das Verfahren der Kondensation mit vorgeschalteter Adsorption ist als Alternative zur thermischen Nachverbrennung hervorzuheben, da Wärmepumpen hier besonders effizient eingesetzt werden können. Denn diese können sehr hohe Wirkungsgrade erreichen, wenn sie sowohl Wärme wie auch Kälte bereitstellen. Wärme wird bei der Adsorption zum Lösen der Lösemittel aus dem Aktivkohlefilter benötigt, Kälte für die Kondensation der Lösemittel aus der Abluft. Zudem kann die Abwärme der Wärmepumpe für weitere Prozesse im Unternehmen genutzt werden. Der Einsatz von Wärmepumpen zum gleichzeitigen Heizen und Kühlen bietet sich bei allen Branchen an, in denen im großen Umfang thermische Prozesse stattfinden
Umsetzung
Grundlegend sollten zunächst Maßnahmen überprüft werden, die zu einer Reduktion des Einsatzes organischer Lösungsmittel führen. Für die Umstellung auf eine Kondensation mit vorgeschalteter Adsorption ist 2 zu prüfen, ob sich die vorhandenen Anlagen mit Abgasen hierfür eignen. Das wesentliche Ausschlusskriterium sind mögliche toxische Bestandteile in der lösungsmittelhaltigen Abluft, die eine Rückgewinnung verhindern können. Deswegen ist zunächst die lösungsmittelhaltige Abluft zu erfassen und zu messen.
Über die Analyse der Bestandteile in der Abluft und eine Betrachtung des Massenstroms ergibt sich, ob eine Umrüstung auf eine Kondensation zur Rückgewinnung der Lösungsmittel möglich ist und welche anderen Abgasreinigungsmöglichkeiten einsetzbar wären. Hierfür sind entsprechende Fachexpertinnen und -experten einzubeziehen. Bei einer positiven Entscheidung kann in einem nächsten Schritt überprüft werden, ob der Einsatz einer Wärmepumpe in Frage kommt.
Hierfür sind die thermischen Prozesse im Unternehmen zu untersuchen und auf die Kompatibilität mit einer Wärmepumpe zu überprüfen. Kann eine Wärmepumpe eingesetzt werden, ist zu prüfen, ob diese sowohl die Wärme als auch Kälte für die Prozesse der Kondensation und Adsorption bereitstellen kann. Die Maßnahme ist mit einem vergleichsweise großen Aufwand verbunden, da der gesamte Prozess der Abluftreinigung umgestellt werden muss und ein Technologiewechsel erfolgt. Für die entsprechende Dimensionierung und fachgerechte Umsetzung müssen Ingenieure beziehungsweise Fachexpertinnen hinzugezogen werden. Bei erfolgreicher Umsetzung der Maßnahmen kann die Wärmepumpen einen COP von 7 bis 10 erreichen und somit zu Energieeinsparungen von bis zu 95 Prozent im Vergleich zur thermischen Nachverbrennung führen. Damit geht auch eine erhebliche Kostenreduktion einher. Gleichzeitig führt die Rückgewinnung der Lösungsmittel dazu, dass diese nicht verbrannt werden und somit die Umwelt belasten, hauptsächlich durch die Emission von CO2.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Der Einsatz der Kondensation ist abhängig vom Gehalt der Lösungsmittel in der Abluft. Ist dieser zu gering, ist eine Rückgewinnung nicht möglich oder nicht wirtschaftlich. Entsprechend kann wie bereits beschrieben eine vorherige Adsorption erfolgen, um den Anteil im Abluftstrom zu erhöhen. Eine weitere Herausforderung sind Begleitstoffe in der Abluft, beispielswiese Stäube, Nebel, Säuren, Hochsieder oder Ammoniak. Falls diese Begleitstoffe vorhanden sind, ist eine Kondensation nicht möglich. Entsprechend sind dann andere Optionen zu betrachten, die im Vergleich zur thermischen Nachverbrennung eine effizientere Abgasreinigung ermöglichen: etwa die biologische Oxidation, die Fotooxidation oder die katalytische Nachverbrennung. Der Einsatz einer Wärmepumpe wäre für diese Verfahren ebenfalls neu zu bewerten.
Fördermöglichkeiten
Die Umstellung der Abgasreinigung auf effizientere und CO2-ärmere Verfahren ist förderfähig. Im Wesentlichen fällt die Umstellung unter Modul 4 (Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen) der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Praxisbeispiel
Intelligentes Wärmepumpensystem: hält die Luft rein und schont Ressourcen
Die Firmen SIMAKA GmbH und Albert Rechtenbacher GmbH haben eine automatische Kunststofflackierstraße energetisch modernisiert. In diesem Rahmen wurde eine Kondensation mit vorgeschalteter Adsorption bei der Abluftbehandlung umgesetzt. Dieses Verfahren ersetzt die thermische Nachverbrennung. Die Energie für die Kondensation und Adsorption wird hierbei über eine Wärmepumpe bereitgestellt. Durch die energetische Modernisierung kann eine jährliche Energieeinsparung von 1.243 MWh erzielt werden.
Darüber werden 95 Prozent des Gasverbrauchs eingespart. Durch die Maßnahme können insgesamt etwa 1.100 MWh Gas und somit ca. 51.000 € an Betriebskosten pro Jahr eingespart werden. Aufgrund der geringen VOC-Konzentrationen in der Abluft erfolgt die Aufkonzentration über zwei abwechselnd beladbare Aktivkohlefilter. Der Wärmebedarf für die Reinigung der Filter wird durch die frei werdende Kondensationswärme (Abkühlung auf - 25 bis - 30 °C bei Abscheidung VOC) über eine Wärmepumpe gedeckt. Diese erreicht mit den erforderlichen Temperaturniveaus eine hohe Leistungszahl (COP) von 7 bis 10. Weiterhin wird die Abwärme der Wärmepumpe zur Erwärmung des Reinigungswassers und zur Gebäudeheizung genutzt. Zusätzlich können etwa 1 bis 2 t Lösemittel zurückgewonnen werden. Dies führt zu einer Ausgabenreduktion von in etwa 6.000 € pro Jahr.
| Unternehmensgröße | Mitte |
| Investitionssumme | 100.000 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 143 MWh |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 1.100 MWh |
| CO2-Einsparung/ a | 309 t |
| Kosteneinsparung | 51.000 € |
| Amortisationszeit | 0 – 3 a |
| Rentabilität | Gut |
| Nutzungsdauer | 15 – 20 a |
- Größe: 580 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
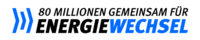
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Auszug aus einer Publikation des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Beitrag von Heiko Reckert, Senior Referent Energie- und Klimaschutzpolitik beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V., zu den neuen Anforderungen aus GEG und EPBD (27.2.2024).
Beitrag von Eckard von Schwerin, Key Account Manager bei der KfW,, zu den Förderprogrammen der KfW-Bank zur Steigerung von Energie und Senkung von CO2-Emissionen im Gebäudebereich. (13.2.2024)
Seit dem 1. Januar 2024 müssen neu eingebaute Heizungsanlagen im Grundsatz einen Anteil von 65 % erneuerbare Energien vorweisen. Es sind vielfältige Übergangsfristen vorgesehen.
Die Verordnung "zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" gilt seit dem 1. Oktober 2022.
Der Leitfaden soll es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der Logistik Anregungen für Optimierungspotenziale bieten.
