Bedarfsgerecht heizen: Absenken der Vorlauftemperatur und Einstellen der Heizkurve
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Organisatorisch
Beschreibung
Hier kann viel Wärmeenergie eingespart werden, indem die Vorlauftemperatur der Heizung außerhalb der Nutzungszeiten des Gebäudes zentral abgesenkt wird. Auch die Optimierung der Heizkurve kann die Energieeffizienz steigern. Hierzu werden die Steilheit und das Niveau der Heizkurve am Wärmeerzeuger angepasst.
Einordnung
Je schlechter die Gebäudedämmung und je größer die Differenz zwischen der Temperatur in beheizten Innenräumen und der Außentemperatur ist, desto mehr Wärme geht über die Gebäudehülle verloren. Diese Verluste müssen durch eine höhere Vorlauftemperatur der Heizung ausgeglichen werden. Ist etwa an Wochenenden die Innentemperatur in Bürogebäuden genauso hoch wie in der Nutzungszeit, treten recht große Wärmeverluste auf, die leicht zu vermeiden wären. Dies gilt insbesondere auch nachts, wenn die Außentemperatur sinkt. Außerhalb der Nutzungszeit sollte daher die Vorlauftemperatur des Heizsystems abgesenkt werden, sodass bei gleicher Heizkörpereinstellung eine geringere Raumtemperatur bereitgestellt wird. So können schnell zwischen 5 und 10 Prozent der Heizenergie eingespart werden.
Am Heizkessel lassen sich über die Einstellung der Heizkurve auch einzelne Heizkreise und -gruppen temporär absenken. Dabei ist die Reaktionszeit des Systems zu berücksichtigen, die bei Heizungen mit Radiatoren ein bis zwei Stunden, bei Fußbodenheizungen drei bis vier Stunden betragen kann. Um feuchten Stellen und Schimmelbildung vorzubeugen, sollte die Raumtemperatur nicht unter 16 °C fallen.
Sowohl Gas- und Heizölkessel als auch Pellet- und Holzschnitzelkessel eignen sich für eine Nachtabsenkung, da sie leistungsstark sind und in der Aufheizphase schnell wieder höhere Vorlauftemperaturen erreichen. Wärmepumpen in Kombination mit Fußbodenheizung sind hingegen für eine Nachtabsenkung oft ungeeignet.
Umsetzung
Die Absenkung der Vorlauftemperatur lohnt sich bei schlecht gedämmten Gebäuden mit einem leistungsstarken Heizsystem, das eine kurze Reaktionszeit besitzt. Wenn die Raumtemperatur in einer kalten Nacht um mindestens 3 °C absinkt, ist eine Nachtabsenkung sinnvoll, sonst nur bei längeren Nicht-Nutzungszeiten.
Zunächst müssen die Räume oder Gebäudebereiche identifiziert werden, die sich für eine Temperaturabsenkung eignen. Die Prüfung sollte durch einen Energieverantwortlichen oder durch Heizungsfachpersonal erfolgen. Geeignet sind Räume, in denen sitzende oder stehende Tätigkeiten mittlerer Belastung gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ausgeführt werden. Außerdem hängt die Eignung von der Art der Beheizung und der Fläche der Heizkörper ab.
Für die Räume, die sich für eine Temperaturabsenkung eignen, werden anschließend die zugehörigen Heizkreise identifiziert. Zudem muss grundsätzlich überprüft werden, ob die Einstellung von verschiedenen Vorlauftemperaturen und Volumenströmen für Luft- oder Warmwasserheizung technisch machbar ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Vorlauftemperatur schrittweise um 2 °C gesenkt werden, wobei mit jeder Absenkung die Auswirkungen auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit überprüft werden sollten. Die Vorlauftemperatur wurde zu stark abgesenkt, wenn Kondensationsprobleme an Wänden oder Decken auftreten, oder wenn die Temperatur unter 16 °C in Räumen fällt, die normalerweise eine Tagestemperatur von 20 °C haben.
Bei der Temperaturabsenkung sind auch die Reaktionszeiten des Heizsystems zu berücksichtigen. Daher lohnt sich häufig nur eine Nachtabsenkung zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Erfahrungsgemäß können durch eine Temperaturabsenkung über acht bis neun Stunden täglich mit jedem Grad abgesenkter Raumtemperatur 2 Prozent an Heizenergie eingespart werden.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Gemäß der ArbStättV müssen bestimmte Temperaturen am Arbeitsplatz gewährleistet werden: 19 – 20 °C bei sitzenden Tätigkeiten, 17 – 19 °C bei Tätigkeiten mittlerer Belastung (zum Beispiel im Stehen, Gehen oder bei der Montage). Diese Temperaturen sollten bei einer zeitweisen Temperaturabsenkung zu den Nutzungszeiten nicht unterschritten werden.
Zudem kann sich das Temperaturempfinden bei Mitarbeitenden individuell unterscheiden, auch abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes. So kann es in derselben Produktionshalle Arbeitsplätze geben, die mit mehr oder weniger körperlicher Anstrengung verbunden sind. Die betroffenen Mitarbeitenden sollten sich zunächst darüber verständigen, welcher genaue Zeitbereich für die Absenkung der Temperatur in der Nacht und an Wochenenden geeignet ist. Entsprechend können Heizungsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten starten, um Raumtemperaturen zeitlich begrenzt abzusenken und zu allen Zeiten ein angenehmes Raumklima sicherzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass ausgeprägte Kälteperioden auch zu kürzeren Absenkzeiten führen können.
Wechselwirkungen zu anderen Maßnahmen
Wenn im Betrieb bereits Maßnahmen zur Energieträgersubstitution geplant sind, zum Beispiel durch den Einsatz von Wärmepumpen zur Heizwärmerzeugung, müssen die nächtlichen Absenkzeiten am Morgen verkürzt werden. Wird der Wärmeschutz des Gebäudes stark verbessert und dadurch der gesamte Wärmeenergiebedarf deutlich gesenkt, vermindert sich der Einspareffekt durch die Temperaturabsenkung. Auf der anderen Seite kann aber die Absenkzeit verlängert und die Temperatur eventuell stärker abgesenkt werden.
Praxisbeispiel
Raumtemperaturabsenkung über Nacht und an Wochenenden
Ein mittelgroßes Unternehmen beheizt für Produktion und Verwaltung eine Fläche von 14.380 m2. Die Gebäude wurden alle vor 1975 erbaut und sind nur teilweise wärmetechnisch saniert. Ihr durchschnittlicher Heizenergiebedarf liegt bei etwa 160 kWh je m2 und Jahr. In Gruppengesprächen und nach einer probeweisen nächtlichen Temperaturabsenkung während einer Heizperiode von Oktober bis Mitte Dezember einigt man sich auf folgende Regelung unter der Woche:
- Die Heizung soll circa zwei Stunden vor Nutzungsbeginn auf Tagesbetrieb schalten.
- Die Heizung kann eine halbe bis eine Stunde vor Nutzungsende heruntergefahren werden.
- Die Temperaturabsenkung kann bis zu 5 °C betragen, das heißt, die Raumsolltemperatur wird von 21 °C auf 16 °C gesenkt.
Bei Verwaltungsbereichen und Kantine liegen die Stundenzahlen der Nachtabschaltung etwas höher, bei Produktionsflächen mit Zweischichtbetrieb etwas niedriger. Der temperaturbereinigte Brennstoffbedarf kann auf diese Weise um 4,7 Prozent reduziert werden. Auch der Pumpstrombedarf sinkt leicht.
| Unternehmensgröße | 480 Mitarbeitende |
| Investitionssumme | - |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 5.700 kWh/ a |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 108.000 kWh/ a |
| CO2-Einsparung/ a | 24,2 t/ a |
| Kosteneinsparung | 15.970 €/ a |
| Amortisationszeit | - |
| Rentabilität | - |
| Nutzungsdauer | 5 Jahre |
- Größe: 592 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
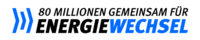
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Auszug aus einer Publikation des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Beitrag von Heiko Reckert, Senior Referent Energie- und Klimaschutzpolitik beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V., zu den neuen Anforderungen aus GEG und EPBD (27.2.2024).
Beitrag von Eckard von Schwerin, Key Account Manager bei der KfW,, zu den Förderprogrammen der KfW-Bank zur Steigerung von Energie und Senkung von CO2-Emissionen im Gebäudebereich. (13.2.2024)
Seit dem 1. Januar 2024 müssen neu eingebaute Heizungsanlagen im Grundsatz einen Anteil von 65 % erneuerbare Energien vorweisen. Es sind vielfältige Übergangsfristen vorgesehen.
Die Verordnung "zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" gilt seit dem 1. Oktober 2022.
Der Leitfaden soll es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der Logistik Anregungen für Optimierungspotenziale bieten.
