Regelung und Optimierung von Ventilatoren
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Bundesweit
Mittelfristig (2 bis 6 Monate)
Mittel
Beschreibung
Durch ihre Optimierung kann der Stromverbrauch der Ventilator-Motoren erheblich verringert werden. Auch durch die Reduktion von Wärmemengen, die über den Luftstrom transportiert werden, lässt sich Energie einsparen. Gründe für einen unnötig hohen Stromverbrauch sind etwa Leckagen oder Einstellungen, die nicht zu den Erfordernissen der Lüftung, oder des (Ab-) Lufttransports passen.
Einordnung
Verborgen in Maschinen, Anlagen, Rohren oder viereckigen Luftkanälen werden Ventilatoren in fast jedem Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb eingesetzt. Für den alltäglichen Normalbetrieb sind sie allerdings oft überdimensioniert. Gründe für eine zu hohe Maximalleistung von Ventilatoren können sehr selten auftretenden Sondersituationen oder technische Vorschriften sein. Dies ist problematisch, da überdimensionierte Ventilatoren nicht nur eine größere Investition darstellen, sondern insbesondere auch unnötig hohe Betriebskosten aufgrund des hohen Strombedarfs verursachen.
Eine Überdimensionierung lässt sich an der Drosselung durch einen Schieber, einen Bypass oder ein Ventil bei konstanter Förderhöhe und konstantem Volumenstrom im Normalbetrieb erkennen. Der Druckverlust durch eine solche hilfsweise Drosselung führt zu vermeidbaren Stromverlusten, die proportional zum Druckabfall und zum Förderstrom sind. Daher sollte die Leistung der Ventilatoren sachgerecht geregelt werden. Daneben lohnt es sich, weitere Aspekte zu prüfen, die die Effizienz von Ventilatoren steigern können.
Umsetzung
Um festzustellen, wo Optimierungsbedarf besteht, sollten zunächst relevante Daten der vorhandenen Ventilatoren gesammelt werden. Sind in einem Betrieb sehr viele Ventilatoren installiert, beispielsweise in der Holzverarbeitung oder in pharmazeutischen Betrieben, ist eine Dokumentation der größten Ventilatoren oder Ventilatoren-Gruppen sinnvoll. Alternativ können gezielt alle Ventilatoren für wenige ausgewählte Anwendungen geprüft werden, zum Beispiel Raumlufttechnische Anlagen, Stofftransport oder Absauganlagen.
Folgende Merkmale sollten erfasst werden: Ventilatortyp (axial oder zentrifugal), Volumenstrom (m³/ s), Gegendruck (Pa), Motorleistung (kW), Betriebspunkt, Jahresbetriebsstunden, Regelung (Frequenz-Umrichter oder Polumschaltung) und Kraftübertragung (direkt oder Keilriemen). Im Anschluss an die Datenaufnahmen kann die Optimierung der Ventilatoren an zahlreichen Systemkomponenten ansetzen. Zum Beispiel neigen insbesondere flexible Verbindungen und Bereiche mit hoher Vibration zu Leckagen. Um unnötige Stromverluste zu vermeiden, sollte daher zunächst die Dichtheit des Leitungsnetzes oder Rauchabzugs kontrolliert werden.
Auch ein bedarfsgerechter Zeitplan für die Belüftung kann den Bedarf an Strom und Heizenergie stark verringern. Belüftungserfordernisse können sich im Zeitverlauf ändern. Daher sollte regelmäßig geprüft werden, ob die Belüftung im bestehenden Umfang notwendig ist, oder ob Leistung und Laufzeit der Ventilatoren reduziert werden können. Beispielsweise können Verbraucher in Verwaltungs- und Produktionsgebäuden außerhalb der Arbeitszeiten abgeschaltet werden. Werden zusätzlich die CO2-Konzentrationen und Luftfeuchte in Innenräumen gemessen, lässt sich die Ventilation noch effizienter regeln.
Darüber hinaus kann sich der Einsatz von Frequenzumrichtern (FU) lohnen. Bei Elektromotoren sorgen FU für eine stufenweise oder kontinuierliche Volumenstromregelung. Auf diese Weise kann viel Strom eingespart werden, insbesondere, wenn häufig unter 75 Prozent der Nennlast gefahren wird. Sehr rentabel ist es auch, normale Elektro-Motoren am Ventilator durch Hocheffizienzmotoren zu ersetzen. Bei kleineren Bauarten (< 0,5 kW) lohnt sich oft sogar ein kompletter Austausch der Ventilatoren, da ältere Modelle häufig sehr schlechte Wirkungsgrade haben.
Bei einer Kraftübertragung durch Riemen kann die Drehzahl des Ventilators über die Größe der eingesetzten Riemenscheibe angepasst werden. Zudem sollten die Lager der Ventilatoren gemäß den Wartungsvorschriften geschmiert werden. Auch dies sorgt für einen effizienteren Einsatz. All diese Maßnahmen zeigen, wie dank einer verbesserten Regelung, einer regelmäßigen Wartung oder kleiner Investitionen viel Antriebsenergie gespart werden kann.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Für den Einbau von FU oder den Austausch alter Motoren durch Hocheffizienz-Motoren ist entsprechende Expertise nötig. Ingenieurbüros für Fachplanung sind hier gute Ansprechpartner, ebenso wie Energiedienstleister oder Motorenanbieter.
Fördermöglichkeiten
Ein Investitionszuschuss für den Ersatz oder die Erstbeschaffung von hocheffizienten Elektro-Motoren und Ventilatoren kann über die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) in Modul 1 beantragt werden.
Wechselwirkungen zu anderen Maßnahmen
Wenn das Luftfördervolumen durch veränderte Raumnutzung oder Prozessparameter (zum Beispiel Betriebszeit oder Stoffkonzentrationen) angepasst wird, verändert sich auch der Strombedarf der betroffenen Ventilator-Systeme. Dies kann auch den Energieverlust an anderer Stelle beeinflussen, zum Beispiel bei der Raumwärme.
Co-Benefits
Mit einer optimierten Einstellung wird häufig auch die Schallemission des Ventilators verringert. Bei Raumlufttechnischen Anlagen vermindert sich oft auch der Heizenergie- beziehungsweise Kältebedarf.
Praxisbeispiel
Sanierung Raumlufttechnischer Anlagen bei Siemens
Zwischen 2015 und 2020 hat die Firma Siemens ein Energieeffizienzprogramm mit einem Umfang von 100 Mio. € umgesetzt. In diesem Rahmen wurden an den Standorten Rastatt und Karlsruhe mit Verwaltungs-, Forschungs- und Produktionsbereichen die Raumlufttechnischen Anlagen analysiert und folgendermaßen angepasst: Die Antriebsmotoren der Ventilatoren wurden durch hocheffiziente bedarfsgeregelte Motoren ersetzt. Am Standort Karlsruhe wird zudem der Volumenstrom anhand der Konzentration von CO2 in der Raumluft geregelt. Der dabei verminderte Heizenergie- und Kühlbedarf wurde nicht ausgewiesen.
Diese Sanierungsinvestition für zwei großindustrielle Standorte lässt sich für mittelständische Betriebe schätzungsweise um einen Faktor 10 herunterskalieren. Unter diesem Aspekt handelt es sich um eine gering-investive Maßnahme. Grundsätzlich mögliche Investitionszuschüsse seitens des BAFA sind in der nebenstehenden Berechnung nicht berücksichtigt.
| Unternehmensgröße | Ca. 2.000 Beschäftigte |
| Investitionssumme | 98.100 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 209.900 kWh/ a |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | - |
| CO2-Einsparung/ a | 88,2 t/ a |
| Kosteneinsparung | 45.580 € |
| Amortisationszeit | 2,2 Jahre |
| Rentabilität | 139.145 € |
| Nutzungsdauer | 7 Jahre |
- Größe: 568 KB
Datum: 11.10.2023
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
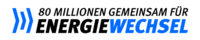
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 11. Oktober 2023Verwandte Artikel
Beitrag von Max Ulrich, Meterologe und Inhaber von Atmovera, einem Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert auf Klimarisiken (4.4.2024).
Strategien für Energieeffizienz bezeichnet die Nutzung von weniger Energie zur Erstellung einer Dienstleistung oder eines Produkts.
Automatisierte Regelung der Betriebszeiten dank elektronischer Steuerung.
Der Leitfaden des Umweltbundesamtes (UBA) unterstützt Verwaltungen dabei, ihre Vorbildfunktion im Klimaschutz zu verbessern. Auch für Unternehmen bietet er eine gute Orientierung.
Wärmepumpen in Gewerbe und Industrie: Energieeffizienz steigern und Förderungen nutzen.
In vielen Unternehmen sind Kühlmöbel mit einer älteren Energieeffizienzklasse im Einsatz. (IEEKN)
