Interne Wärmerückgewinnung bei thermischen Prozessen nach Pinch-Analyse
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
ab 1000
Bundesweit
Mittelfristig (2 bis 6 Monate)
Hoch
Beschreibung
Die strukturierte Methode wurde in den 1980er Jahren für energieintensive Produktionsverfahren, etwa in Raffinerien, entwickelt. In den letzten Jahren ist sie jedoch auch für weitere Industriebranchen und kleinere Betriebe zugänglich geworden. Mithilfe der Pinch-Analyse können bis zu 30 Prozent an thermischer Energie in der Bereitstellung eingespart werden.
Einordnung
Der Industriesektor in Deutschland verbraucht ein Viertel der Endenergie, wovon zwei Drittel auf die Bereitstellung von Prozesswärme und -kälte entfallen. Damit einher geht auch ein hoher Anteil an Treibhausgasemissionen und an betrieblichen Kosten, die aus der prozessbedingten Wärme- und Kältebereitstellung entstehen. Eine Möglichkeit, diese zu senken, ist die Energieeffizienzsteigerung bei einzelnen Anlagenkomponenten in einem Produktionsbetrieb. Darüber hinaus kann aber auch viel Energie gespart werden, wenn die thermischen Energieströme im Gesamtsystem einer oder mehrerer Anlagen optimal verknüpft sind. Mithilfe einer Pinch-Analyse, auch Prozessintegration genannt, wird die Energieversorgung auf Prozess- und Anlagenebene optimiert. Für die interne Wärmerückgewinnung werden hierbei Wärmeströme in Bestandsanlagen mittels Wärmeübertragern ideal miteinander verschaltet. Die Pinch-Analyse zielt darauf ab, Wärmeströme entsprechend ihres Temperaturniveaus so zu verbinden, dass der kleinstmögliche Energiebedarf für die Bereitstellung von Kälte und Wärme in den Prozessen entsteht. Anhand der Analyse kann eine veränderte Verschaltung für Wärmezuführung und Abwärmenutzung in einem Bestandsanlagen-Bereich geplant und umgesetzt werden.
Die Anwendung der Pinch-Analyse ist besonders erfolgversprechend, wenn Wärme- und Kältebedarfe auf unterschiedlichen Temperaturniveaus vorhanden sind und externe Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten (beispielsweise zur Raumheizung) ausgeschöpft oder nicht möglich sind. Mithilfe der Pinch-Analyse lassen sich Einsparungen von 10 bis 30 Prozent bei der thermischen Energieversorgung erreichen. Jedoch lässt sich der Nutzen der Methode für individuelle industrielle Prozesse vorab schwer abschätzen.
Umsetzung
Bei der energetischen Optimierung von thermischen Prozessen sollten zunächst immer Energieeffizienzpotenziale der Kernprozesse gehoben werden (zum Beispiel bessere Wärmdämmung von Flanschen, Maschinen oder Öfen), bevor die Wärmeströme mittels Pinch-Analyse optimiert werden. Diese Optimierung umfasst zunächst die Beschreibung und das Verständnis aller Prozessströme. Dieser Schritt nimmt etwa zwei Drittel des gesamten Zeitaufwands der Analyse ein, da es hierfür keine standardisierten Verfahren gibt und bei fehlenden Daten eventuell zusätzliche Messungen durchgeführt werden müssen.
Zur Datenerfassung können Hydraulikschemata, Verfahrens-Ablaufdiagramme und Parameter aus Prozessleitsystemen genutzt werden, um die Temperaturniveaus und Wärmemengen der Teilprozesse zu bestimmen.
Im zweiten Schritt werden die vorhandenen Wärme- und Kühlbedarfe verschiedener Prozesse zu Verbundkurven zusammengefasst. Die zwei Verbundkurven für kalte (aufzuheizende) und warme (abzukühlende) Energieströme spiegeln den Kühl- und Heizbedarf des Gesamtprozesses wider und sind das zentrale Instrument der Pinch-Methode. Dabei werden verschiedene Ströme in gleichen Temperaturintervallen nach dem Superpositionsprinzip zusammengefasst dargestellt, wobei die benötigte Energiemenge gleichbleibt. Die beiden Verbundkurven für kalte und warme Ströme lassen sich nun nebeneinanderlegen und seitlich gegeneinander verschieben, bis sie sich in einem Punkt, dem Pinch-Point, berühren, bzw. an diesem Punkt eine minimale Temperaturdifferenz aufweisen . Der Überlappungsbereich beider Kurven zeigt auf der horizontalen Achse den maximal möglichen Wärmestrom durch Wärmerückgewinnung an. Der vertikale Abstand der Kurven in diesem Bereich ergibt das maximale treibende Temperaturgefälle der entsprechenden Wärmeübertragung. Links des Überlappungsbereichs besteht ein Wärmeüberschuss, der aus dem Prozess abgeführt werden muss und gegebenenfalls für eine externe Abwärmenutzung zur Verfügung steht. Rechts des Bereichs der Wärmerückgewinnung besteht ein Wärmedefizit, das durch externe Wärmezufuhr gedeckt werden muss.
Im Anschluss an die Pinch-Analyse erfolgt eine Überprüfung auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit der Integration. Dabei spielen sowohl der Platzbedarf für Wärmetauscher und die räumliche Distanz der Anlagenteile als auch die notwendige Flexibilität des Produktionsprozesses mit An- und Abfahrprozessen eine wichtige Rolle. Liegen einzelne Anlagenteile weit auseinander, müssen Wärmeverluste in Wärmeleitungen in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung integriert werden. Durch eine Gegenüberstellung des minimalen Heiz- und Kühlbedarfs aus der Pinch-Analyse und des tatsächlichen Energieverbrauchs der Anlage lassen sich mögliche Einsparpotenziale näherungsweise abschätzen.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Erfassen aller Prozessströme und deren Temperaturen
Erstellen von Verbundkurven für kalte und warme Energieströme
Pinch-Analyse und Grobplanung von Wärmetauschern, Speichern und Wärmepumpen
Technische Umsetzbarkeit prüfen
Wirtschaftliche Umsetzbarkeit prüfen
Detailplanung von Wärmetauschern, Speichern und Wärmepumpen
Co-Benefits
Die Pinch-Analyse hilft dabei, einen Überblick über die thermischen Prozesse in der Produktion zu erhalten und kann Optimierungsansätze in Bezug auf Produktqualität und Materialeinsparungen liefern.
Fördermöglichkeiten
Für Investitionen zur energetischen und ressourcenorientierten Optimierung von industriellen und gewerblichen Anlagen und Prozessen ist eine Förderung von bis zu 50 Prozent über die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Modul 4 „Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ möglich.
Praxisbeispiel
Optimierung eines kontinuierlichen Reaktionsprozesses in der Feinchemie
In einer Produktionsanlage der Feinchemie werden zur Herstellung einer Grundchemikalie zwei Edukte (Reaktant A und Reaktant B) in einem Reaktor prozessiert. Anschließend wird das Reaktionsgemisch in einer Destillationskolonne in das Produkt C sowie einen Recycling-Strom aufgetrennt. Das Reaktionsgemisch wird vor dem Eintritt in die Kolonne erwärmt. Das Produkt und der Recycling-Strom werden nach der Kolonne abgekühlt.
Die bestehende Anlage umfasst zwar eine Wärmerückgewinnung. Die Kühlleistung für das ausgeschleuste Produkt C birgt jedoch noch ein erhebliches Potenzial zur Abwärmenutzung. Nach Durchführung der Pinch-Analyse wird ein weiterer Wärmetauscher eingebaut, um die Abwärmeströme oberhalb und unterhalb des Pinch-Points zu nutzen. Zudem wird die Verrohrung geändert. Die Entwicklungs- und Entscheidungskosten der Pinch-Analyse in Höhe von 30.000 € sind in der Investitionssumme enthalten. Die jährlichen Reinigungskosten der zusätzlichen Wärmeübertrager sind ebenfalls durch Abzug von den jährlich eingesparten Energiekosten berücksichtigt.
| Unternehmensgröße | Größeres Unternehmen |
| Investitionssumme | 189.000 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | - |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 1.915.000 kWh |
| CO2-Einsparung/ a | 387 t |
| Kosteneinsparung | 210.650 €/ a |
| Amortisationszeit | 0,9 Jahre |
| Rentabilität | 1.224.000 € |
| Nutzungsdauer | 10 Jahre |
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
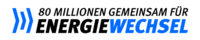
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 06. Februar 2024Verwandte Artikel
Beitrag von Max Ulrich, Meterologe und Inhaber von Atmovera, einem Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert auf Klimarisiken (4.4.2024).
24 % des in Deutschland verbrauchten Erdgases dienen der energetischen Bereitstellung von Prozesswärme. Wo technisch möglich, kann die Elektrifizierung einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Energiekosten und Treibhausgasemissionen senken durch Abwärmenutzung
Auszug aus einer Publikation des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Strategien für Energieeffizienz bezeichnet die Nutzung von weniger Energie zur Erstellung einer Dienstleistung oder eines Produkts.
Beitrag von Heiko Reckert, Senior Referent Energie- und Klimaschutzpolitik beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V., zu den neuen Anforderungen aus GEG und EPBD (27.2.2024).