Energieeffiziente, bedarfsgerechte Raumwärme durch automatisierte Thermostate
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
250-499
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
Die größere Verbreitung von mobilen Arbeitsmodellen mit geringer Büropräsenz hat das Nutzungsverhalten in den letzten Jahren jedoch stark verändert. Zur Steigerung der Energieeffizienz kann in Räumen, die temporär nicht genutzt werden, das Regelverhalten der Heizkörperthermostate möglichst einfach und automatisiert an den Bedarf angepasst werden.
Einordnung
In vielen Büro- und Verwaltungsgebäuden sind Heizkörper mit Standardthermostate mit Stufen von 1 bis 5 und einer Frostschutzstufe verbaut, die manuell nach Bedarf verstellt werden können.
Der Energiebedarf für die Raumwärme ist damit zum Großteil von den Thermostateinstellungen durch die Raumnutzenden abhängig und lässt sich nur durch generelle Nacht- und Wochenendabsenkungen an der Heizungsanlage zentral optimieren. Sind Räume mehrere Tage nicht in Benutzung, werden die Thermostate oft nicht heruntergedreht, so dass diese oft unnötig stark geheizt werden. Die Installation einer umfassenderen Gebäudeautomation ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Es müssen Kabel verlegt, Sensoren und Aktoren verbaut und die zentrale Steuereinheit programmiert werden.
Eine einfachere und schnellere Alternative zumindest für kleinere Liegenschaften ist der Einbau von motorgetriebenen Thermostatventilen an den einzelnen Heizkörpern, wie sie im Wohnungsbereich unter dem Stichwort Smart Home zum Einsatz kommen. Für den Einsatz in größeren Liegenschaften sind diese Standardlösungen jedoch nicht ideal, da die Größe der Gebäude und der Wartungsaufwand, etwa beim Batteriewechsel, die Verwendung dieser bewährten Technik aufwändig macht.
Für größere Liegenschaften bieten sich Thermostatventile an, die beispielsweise nach dem LoRaWAN-Standard (Long Range Wide Area Network) arbeiten. Dabei handelt es sich um eine Funktechnik, durch die eine große Funkreichweite bei sehr geringem Energieverbrauch realisierbar ist. Diese Thermostate lassen sich dann auch zentral steuern und regeln.
Umsetzung
Für die anfängliche Bedarfsanalyse ist nach einer ers-ten Sichtung, ob beispielsweise die Raumpläne bezüglich der Raumnutzung noch aktuell sind, die Anzahl der benötigten Ventileinheiten zu ermitteln.
Eine Gruppierung vergleichbar genutzter Räume ermöglicht die Bildung von Nutzungsszenarien, die die Implementierung durch Standardisierung vereinfachen. So sollten beispielsweise Standardbüroräume mit einer Kernzeitbelegung zwischen 7 und 19 Uhr an Werktagen in diesem Zeitraum warm sein. Weitere Beispiele für Raumgruppen sind Konferenzräume, Sanitär- und Umkleideräume sowie ständig belegte Räume, zum Beispiel Leitstände.
Aufgrund der heterogenen Nutzungsstruktur größerer Liegenschaften sollten die Nutzungsanforderungen klar definiert sein, ebenso wie die Zeitintervalle für Heizzeiten und Absenkungen der Raumtemperatur. Daher sollte jedes Nutzungsszenario auch ein schlüssiges abgestuftes Bedienkonzept umfassen, in dem die Anforderungen unter Gesichtspunkten der Energieeffizienz mit den Bedürfnissen der Raumnutzenden abgestimmt sind. Hierbei sollte eine indirekte Eingriffsmöglichkeit für die Nutzenden gegeben sein, zum Beispiel über personalisierte Zugänge im Steuerungssystem, um persönliche Präferenzen bei der Raumtemperatur berücksichtigen zu können.
Nach den Planungsschritten erfolgt die Auswahl eines Anbieters von entsprechender Systemtechnik, also motorgetriebenen Thermostatventilen, Funktransmittern und eines Softwarepaketes. Hierbei ist die mögliche Einbindung in vorhandene Systeme zu berücksichtigen. Auch eine Erweiterung um zusätzliche Sensoren und Aktoren für identifizierte weitere Anwendungen kann hier bedacht werden.
Ein sinnvolles Entscheidungskriterium bei der Auswahl eines Technikanbieters sind verfügbare Funktionen für Visualisierungen und Auswertungen ohne aufwändige zusätzliche Hardwarebeschaffungen.
Dies erleichtert im nächsten Schritt die Einführung der Technik. So kann die Montage der Ventilsteuerung, also der Thermostate, durch das eigene Personal vorgenommen werden, ohne dass spezialisierte Fachkräfte hinzugerufen werden müssen.
Auch der Aufbau des Funknetzes sollte durch einfache Bausteine nach dem Plug-and-Play-Prinzip möglich sein. Über eine intuitiv zu bedienende Programmoberfläche ist die Integration der Thermostate, die an den Heizkörpern montiert werden, ohne spezielle Programmierkenntnisse durch eigenes Personal möglich. Eine Kalenderfunktion ermöglicht bei einer Betriebsruhe oder an Feiertagen einen automatisierten Absenkbetrieb.
Durch den LoRaWAN-Standard können auch weitere Sensoren hinzugefügt werden. Fenstersensoren sorgen beispielsweise dafür, dass bei Öffnung des Fensters das Thermostatventil schließt und Präsenzmelder können die Belegung des Raumes automatisiert erfassen, worauf das Thermostat mit gleichem Funkstandard entsprechend reagiert.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Durchführen einer Bedarfsanalyse
Definition von Nutzungsszenarien für Raumgruppen
Auswahl eines Anbieters für die nötige Systemtechnik
Vorbereitung des Funknetzwerkes
Montage der Ventilsteuerungen
Aufbau des Funknetzes und Integration der Thermostate nach dem Bausteinprinzip (Plug-and-Play)
Ggf. Integration von weiteren Sensoren mit gleichem Funkstandard
Herausforderungen und Lösungsansätze
Die Einführung eines geeigneten Smart-Heating-Systems sollte keine Einzellösung darstellen, sondern sich möglichst barrierefrei in bestehende oder vorgesehene Gebäudeautomationskonzepte einfügen. Dafür sind Standardschnittstellen erforderlich, was bei der Auswahl eines Systems zu beachten ist. Auch die Anwendbarkeit für möglichst viele Heizkörpertypen ist zu beachten, da im Bestand mehrere Typen im Einsatz sein können, beispielsweise Radiator- oder Plattenheizkörper.
Ziel der Einführung eines Smart-Heating-Systems sollte das Reduzieren des Energieverbrauchs sein, ohne dass der Komfort der Raumnutzenden sinkt. Um die Akzeptanz der Mitarbeitenden zu steigern, sollte die Einführung eines solchen Systems gut kommuniziert werden. Auch sollten die Bedürfnisse der Raumnutzenden berücksichtigt werden, indem etwa manuelle Eingriffsmöglichkeiten in das Steuerungssystem geschaffen werden.
Co-Benefits
Motorgetriebene Thermostatventile verfügen gegenüber manuellen Ventilen über Vorteile beim Verkalkungsschutz, da in aller Regel ein in das Ventil integriertes Programm dafür sorgt, dass regelmäßig das Ventil auf- und zufährt. Dadurch wird einem Verkalken des Ventils mit Festsitzen vorgebeugt. Dies trägt zu einem geringeren Wartungs- bzw. Reparaturaufwand gegenüber manuellen Ventilen bei.
Praxisbeispiel
Verwaltungsgebäude aus den Achtziger Jahren
Optimiert werden soll ein typisches Verwaltungsgebäude aus den 1980iger Jahren mit einer Nutzfläche von 1.350 m², aufgeteilt auf 25 Räume (Büro- und Sanitärräume, Besprechungsräume, Sozialräume). Pro Raum werden im Schnitt zwei Thermostatventile benötigt, sodass für das Gebäude insgesamt 50 Thermostatventile installiert werden. Die Investitionssumme ergibt sich aus den 50 Ventilen, den notwendigen LoRaWAN-Empfangsstationen sowie zusätzlich für das Beispiel noch 25 Raumtemperaturanzeigen/ -reglern, die ebenfalls per Funk angebunden werden und der Direktanzeige und raumweisen Eingriffsmöglichkeit dienen. Der Wärmeenergiebedarf für die Raumheizung des Verwaltungsgebäudes reduziert sich durch die Umsetzung der Maßnahme um etwa ein Drittel.
| Unternehmensgröße | MIttel |
| Investitionssumme | 12.893 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | - |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 79.886 kWh |
| CO2-Einsparung/ a | 16,1 t |
| Kosteneinsparung | 10.465 €/ a |
| Amortisationszeit | 3,2 Jahre |
| Rentabilität | 52.913 € netto |
| Nutzungsdauer | 10 Jahre |
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
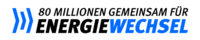
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 06. Februar 2024Verwandte Artikel
Beitrag von Max Ulrich, Meterologe und Inhaber von Atmovera, einem Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert auf Klimarisiken (4.4.2024).
Energiekosten und Treibhausgasemissionen senken durch Abwärmenutzung
Auszug aus einer Publikation des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Strategien für Energieeffizienz bezeichnet die Nutzung von weniger Energie zur Erstellung einer Dienstleistung oder eines Produkts.
Beitrag von Heiko Reckert, Senior Referent Energie- und Klimaschutzpolitik beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V., zu den neuen Anforderungen aus GEG und EPBD (27.2.2024).
Beitrag von Eckard von Schwerin, Key Account Manager bei der KfW,, zu den Förderprogrammen der KfW-Bank zur Steigerung von Energie und Senkung von CO2-Emissionen im Gebäudebereich. (13.2.2024)