Energieeffizienz im Erzeuger- und Verteilerkreis von Kältenetzen
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
In vielen Betrieben ist Kälte für die Prozess- und Raumkühlung in der Produktion unerlässlich. Dabei verbrauchen die Pumpen im Kälte-Versorgungsnetz der Produktionsanlagen einen relevanten Anteil der Gesamtenergie des Systems. Hier kann gespart werden, indem die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Kühl-Verteilerkreises angehoben und der Volumenstrom im Verbrauchernetz verringert wird. Dadurch minimiert sich der Widerstand im Verteilernetz und die Netzpumpen verbrauchen weniger Strom.
Maßnahmenbeschreibung
Einordnung
Der Erzeugerkreis und der Verbraucherkreis eines Kühlsystems sind durch eine hydraulische Weiche oder eine hydraulische Ausgleichsleitung drucklos voneinander entkoppelt. Daher werden die Erzeugeranlagen nicht negativ durch den Verbraucherkreis beeinflusst. Außerdem wird eine Unterversorgung der Verbraucher vermieden, wenn der netzseitige stets unter dem erzeugerseitigen Volumenstrom liegt. Die Fördermengen der Erzeugerkreispumpen werden in Abhängigkeit des geforderten Volumenstroms der Kältemaschinen dimensioniert (konstanter Volumenstrom). Ist der Volumenstrom im Verbraucherkreis höher als im Erzeugerkreis, führt das im Kaltwassernetz zu einer Anhebung der Vorlauftemperatur. Wird dann der Sollwert überschritten, werden weitere Kälteerzeuger durch Folgeschaltung angefordert und die Kälteanlage verbraucht zusätzlich Strom.
Umsetzung
Für einen optimalen Betrieb und eine höhere Energieeffizienz sollten die Pumpen bedarfsgerecht ausgelegt werden. Die Leistung von mit Frequenzumrichtern (FU) geregelten Verbrauchernetzpumpen wird über den Differenzdruck zwischen Saug- und Druckseite geregelt. In der Praxis laufen Pumpen häufig nicht im effizientesten Betriebspunkt. Dies kann an einer überdimensionierten Auslegung, an Fehlern oder Mängeln in der Bestandshydraulik oder an einer fehlenden Parametrierung liegen. Die Parametrierung bei differenzdruckgeregelten Pumpen lässt sich im Betrieb kurzfristig und mit geringem Aufwand beheben. Hierzu wird der voreingestellte Sollwert des Volumenstroms so lange reduziert, bis die gewünschte Temperaturspreizung erreicht ist. Anschließend muss die Verbrauchernetztemperatur im Betrieb regelmäßig auf Veränderungen hin kontrolliert werden. Werden überall die vorgeschriebenen Temperaturen erreicht, kann der iterative Prozess fortgesetzt werden. Bei unerwünschten Veränderungen sollten die Parameter kontrolliert und schrittweise wieder rückgängig gemacht werden. Auch hier empfiehlt sich ein iteratives Vorgehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Regelung der Pumpen sollte im Betrieb angepasst werden. Zur Optimierung muss die Parametrierung der Netzpumpen so eingestellt werden, dass der Volumenstrom gesenkt wird. Dabei passt sich die Vorlauftemperatur auf der Verteilerseite der Vorlauftemperatur der Erzeugerseite an.
Herausforderungen und Lösungsansätze
Fehler oder Mängel im Hydrauliksystem des Verbrauchernetzes können es erschweren, die Regelung der Anlage korrekt einzustellen. Bei älteren Anlagen mit offenen Bypass-Leitungen vor den Verbrauchern zeigt sich häufig auch nach einer angepassten Parametrierung der Netzpumpen nicht der gewünschte Effekt. Wenn sich keine Senkung des Volumenstroms einstellt, müssen entsprechende Fehlerstellen identifiziert werden, die die Wirkung der Maßnahme beeinträchtigen. Ist keine oben beschriebene hydraulische Entkopplung zwischen den beiden Kreisen vorhanden, muss diese zum Beispiel durch die Installation einer hydraulischen Weiche hergestellt werden. Dies übernimmt ein Kälteanlagenbauer. In diesem Zusammenhang kann sich auch die Anschaffung neuer drehzahlgeregelter Netzpumpen lohnen.
Co-Benefits
Gerade bei älteren „gewachsenen” Kältenetzen sollten alle Bereiche des Verteilnetzes auf der Verbraucherseite gründlich untersucht werden. Im Zuge dessen können zum Beispiel die Solltemperaturen an den Verbrauchern hinterfragt und entsprechend angepasst werden.
Erste Schritte bei der Umsetzung
- Anpassung der Netzpumpen-Parametrierung:
- Bestandsaufnahme
- Voreingestellten Sollwert reduzieren
- Kontrolle der Verbrauchernetz-Temperaturen im Betrieb
- Iterativen Anpassungsprozess bis zum gewünschten Ergebnis fortsetzen
Praxisbeispiel
Ein Klimakaltwassernetz wird in einem Klinikbetrieb mit einer geringen Spreizung von 3 Kelvin (K) betrieben. Bislang wurde das System nicht näher auf Effizienz im Betrieb geprüft. Durch den oben beschriebenen iterativen Prozess wird über 3 Anpassungsschleifen festgestellt, dass die Spreizung auf 6 K angehoben werden kann. Da der Zusammenhang linear ist, halbiert sich so der Volumenstrom im Verbrauchernetz. Der Energieaufwand der Verbraucherpumpen wird durch diese Maßnahme erheblich reduziert. Insgesamt fallen 7.000 € für das ausführende Fachunternehmen sowie das Nachrüsten von Sensorik an. Die Pumpen waren bereits zuvor mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Bei einem Klimakältebedarf von etwa 500 kWth (Spitzenlast) wird ein jährlicher Verbrauch von rund 1.000.000 kWhth erfasst. Die Betriebsstundenzahl liegt bei 8.760 h/ a, da die Klinik rund um die Uhr und ganzjährig Kälteenergie für die Klimatisierung und die Kühlung zahlreicher medizinischer Geräte (zum Beispiel MRT) benötigt. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme der Pumpen liegt bei rund 2 kWel, womit der Stromverbrauch bei 17.520 kWh pro Jahr liegt. Durch die Halbierung des Volumenstroms sinkt der Stromverbrauch der Pumpe auf ein Achtel.
| Unternehmensgröße | mittel |
| Investitionssumme | 7.000 € |
| Energieinsparung (Strom)/a | 15.312 kWh/a |
| CO2-Einsparung/a | 6,4 t CO2/a |
| Kosteneinsparung | 4.884,5 €/a |
| Amortisationszeit | 1,4 a |
| Rentabilität | sehr gut |
| Nutzungsdauer | > 5 Jahre |
- Größe: 689 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
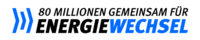
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Strategien für Energieeffizienz bezeichnet die Nutzung von weniger Energie zur Erstellung einer Dienstleistung oder eines Produkts.
Durch die Regelung kann Kühlenergie gespart werden.
Über Modul 6 der EEW wird der Austausch vorhandener Produktionsanlagen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, durch elektrisch betriebene Neuanlagen gefördert.
In vielen Unternehmen sind Kühlmöbel mit einer älteren Energieeffizienzklasse im Einsatz. (IEEKN)
Um IT-Rechenleistungen bereitzustellen, betreiben viele Unternehmen eigene Serverräume. Eine bessere Einstellung der Raumkühlung spart Energie. (IEEKN)
In einzelnen Gebäudebereichen bestehen häufig unterschiedliche Anforderungen an die Raumtemperatur. (IEEKN)
