Optimierung der Fahrweise von Tunnel- und Durchlauföfen
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
In der industriellen Produktion werden thermische Prozesse wie Trocknen oder Brennen in Tunnel und Durchlauföfen meist durch Verbesserung der Qualität und Minimierung von Personal- und Materialkosten optimiert.
Einordnung
Thermische Prozesse wie Trocknen und Brennen werden in vielen Branchen eingesetzt und gleichzeitig relevante Energieverbraucher. In der Ziegel- und Keramikindustrie zum Beispiel werden häufig Trockner und Öfen im Wärmeverbund gefahren. Auch in der Nahrungsmittelindustrie werden Durchlauföfen für Prozesse wie Backen und Rösten eingesetzt. Aber auch spezielle Produktionsverfahren wie beispielsweise die Pulverlackierung nutzen die Prozessfolge Trocknen und Brennen. Im Wärmeverbund wird dabei die Abluft aus den Öfen häufig für die Trocknung verwendet. Der Wärmebedarf der Öfen wird bislang in den meisten Fällen mit fossilen Energieträgern (meist Erdgas) gedeckt.
Kurzfristige Energieeinsparmaßnahmen können sowohl organisatorisch-technischer Art sein, als auch durch klein-investive Maßnahmen realisiert werden. Letztere können außerdem zur Transformation der Produktion hin zu einer Versorgung mit erneuerbaren Energien beitragen. Häufig können bei Trockner-Ofen-Prozessen Energie- und Exergieverluste vermindert werden, indem der Wärmeverbund von Trockner und Ofen energetisch getrennt wird. Exergieverluste entstehen, da die hochkalorische Abwärme aus Öfen ein relativ hohes Temperaturniveau besitzt, für die Trocknung jedoch ein niedrigeres Temperaturniveau ausreichend wäre. Aus diesem Grund begrenzt die energetische Kopplung von Ofen und Trockner die Energieeffizienz-Bemühungen beim Ofen, wenn dessen Abwärme z. B. für die Trocknung von Rohlingen vorgesehen ist.
Die Optimierung des Energiebedarfs sollte beim Tunnelofen ansetzen. Denn aufgrund der sehr hohen Prozesstemperaturen im Ofen werden dort die höchsten Energiekosten im Produktionsprozess verursacht. Der Trockner kann hingegen die Abwärme des Ofens nutzen, beeinflusst aber nicht dessen energieoptimale Prozessführung. Eventuell wird aus dem Ofen nicht genügend Abwärme zur Versorgung des Trockners erzeugt. Dann kann wegen des geringeren Temperaturniveaus im Trocknungsprozess der Energiebedarf durch andere Wärmequellen (zum Beispiel Abwärme von Kompressoren aus der Drucklufterzeugung), Fernwärme oder durch HT-Wärmepumpen effizienter und kostengünstiger gedeckt werden.
Umsetzung
Zur Minimierung des Prozesswärmebedarfs sollten die Massen- und Energieströme in den Teilsystemen von Trockner und Tunnelofen bekannt sein oder zunächst bestimmt werden. Eine volle Besetzung der Rollwägen oder Transportbänder minimiert nämlich den Nutzenergiebedarf des jeweiligen Ofengangs. Werden die Trockner und Öfen nicht im Vierschicht-Betrieb betrieben, müssen die Anlagen täglich oder nach dem Wochenende angefahren werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, die Anlagen nicht zu früh anzufahren, um die Anfahrverluste zu minimieren.
Die An- und Abfahrverluste bei Trocknern und Öfen können außerdem durch optimierte Wochenplanung (entweder Volllast- oder optimierte Teillast-Betriebsweise) minimiert werden. Die Brennkurve (Temperaturniveaus in den einzelnen Ofenzonen) oder die Back- bzw. Röst-Temperaturkurve kann optimiert werden, wenn das Rohmaterial in gleichmäßiger und bekannter Zusammensetzung zugeführt wird. Für diese Aufgabe sollte jeder Betrieb ein geeignetes Prozessoptimierungs-Tool einsetzen. Falls die Brenntemperatur unter etwa 550 °C liegt, sollte geprüft werden, ob sich eine Nachisolation des Ofens rentieren könnte. Diese gering-investive Maßnahme kann die Wärmeversorgung des Trockners beeinflussen und macht meist eine Entkopplung des Betriebs notwendig. Mit zunehmend fluktuierenden Strompreisen besteht bei entkoppeltem Trockner-Ofen-Betrieb die Möglichkeit, in Zeiten mit kostengünstigem Strom (oder negativen Strompreisen) eine elektrische (Zusatz-)Heizung für die Trocknung vorzusehen.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Herausfordernd kann der schwankende Temperaturunterschied im Medium selbst sein, der durch unterschiedliche Maschinen und Betriebsbedingungen hervorgerufen wird. Hier ist eine akkurate und individuelle Planung der Komponenten essenziell. Häufig fällt die Abwärme räumlich getrennt vom Verwendungsbereich an. Dadurch müssen Leitungssysteme installiert werden, was zu erheblichen Kostensteigerungen und Wärmeverlusten führen kann. Abwärme sollte demnach möglichst örtlich dort genutzt werden, wo sie entsteht. Auch die zeitlich getrennte Verwendung von Abwärme und Verbraucher kann zu einer Herausforderung werden. Als Lösung können Warmwasserspeicher dienen, die über einen längeren Zeitraum das Wärmepotenzial zurückhalten. Soll die Abwärme in bestehende Systeme integriert werden, müssen häufig vorhandene Systeme und Prozesse angepasst werden. Hier ist die technische und wirtschaftliche Planung sehr wichtig.
Fördermöglichkeiten
Investitionen in die Wärmeisolation von industriellen Anlagen bis 200.000 Euro können im Rahmen der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft in Modul 1: Querschnittstechnologien durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert werden. Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen Die Optimierung der Fahrweise von Öfen ist eng verknüpft mit den im Factsheet Dämmung von Maschinen und Anlagen vorgestellten Maßnahmen. Diese sollten immer gemeinsam betrachtet werden.
Co-Benefits
Bei gut eingestellten Brenn-, Back- oder Röst-Kurven ist die Qualität der Produkte in der Regel besonders konstant.
Praxisbeispiel
Einsatz eines Optimierungsrechners für die Brennkurve eines Keramik-Tunnelofens
Die Brennkurve eines Keramikbetriebes ist aus langjähriger Erfahrung entstanden. Bei einer geringeren Beladung des Ofens gibt es Unsicherheiten, wie die Brennkurve optimal eingestellt werden kann. Hinzu kommt, dass ein neuer Ofen mit leicht unterschiedlichen Maßen eingesetzt wird. Durch das Einstellen der Temperatur oder der Vorschubgeschwindigkeit der Tunnelofenwägen, sowie durch das Abschalten einzelner Brennergruppen kann der Ofen optimal geregelt werden. Für den Ofen wird ein Ofenoptimierungsrechner angeschafft. Dieser wird zunächst in seinen Algorithmen auf die aus Erfahrung angewendete Volllastfahrweise "geeicht". Bei Teillast und veränderten Keramikrohlingen generiert der Optimierungsrechner etwas andere Brennkurven, als für gewöhnlich gewählt werden. Dadurch sind die Brennstoffverbräuche – je nach Produkt und Beladung – um rund 2 bis 6 Prozent geringer; im Jahresdurchschnitt liegt die Brennstoffeinsparung bei vergleichbarem Produktportfolio, aber ohne Optimierungsrechner, nur bei 3,2 Prozent.
| Unternehmensgröße | Mitte |
| Investitionssumme | 25.900 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 0 |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 70.400 kWh |
| CO2-Einsparung/ a | 14,2 t |
| Kosteneinsparung | 7.750 €/ a |
| Amortisationszeit | 3,3 Jahre |
| Rentabilität | 18.600 € Nettobarwert |
| Nutzungsdauer | 8 Jahre |
- Größe: 651 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
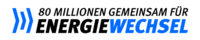
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Ein Standort-Steckbrief ist eines der wichtigsten Instrumente im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Manchmal werden auch die Begriffe Erreichbarkeitsanalyse oder Standortcheck sinngleich verwendet.
Dienstreisen sind wichtig für den Geschäftserfolg und können auch einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß eines Unternehmens leisten.
Elektromobilität im Fuhrpark als Handlungsfeld des betrieblichen Mobilitätsmanagements hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen.
Die Fahrradförderung ist ein wichtiges Handlungsfeld im betrieblichen Mobilitätsmanagement mit Vorteilen für die Beschäftigten und für Arbeitgeber in Bezug auf Kosten, Gesundheit und Zufriedenheit.
Durch ein Mobilitätsbudget werden umweltfreundliche Fortbewegungsmittel attraktiver und der CO2-Ausstoß kann reduziert werden.
Die Förderung der ÖPNV-Nutzung im Betrieb birgt oftmals Potentiale zur Reduzierung von Alleinfahrten und Emissionen auf dem Arbeitsweg.
