Lastganganalyse von Strom und Gas
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Mittel
Beschreibung
So kann die Leistungsaufnahme von Systemen oder Anlagen im Zeitverlauf untersucht werden. Muster, Spitzen und Schwankungen im Strom- und Gasverbrauch geben Aufschluss darüber, wie das System beziehungsweise die Anlage genutzt wird und wo mögliche Einsparpotenziale bestehen.
Einordnung
Energieversorgungsunternehmen sind durch die Stromnetzzugangsverordnung verpflichtet, Stromlastgänge ab einem Verbrauch von 100.000 kWh pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Dann muss eine registrierende Lastgangsmessung (RLM) durchgeführt werden. Mithilfe eines entsprechenden Zählers wird der Stromverbrauch alle 15 Minuten aufgezeichnet und die Daten werden beim Energieversorger gespeichert. Die Gasnetzzugangsverordnung nennt hingegen zwei Kriterien für die Bereitstellung eines RLM-Zählers. Neben einem Jahresverbrauch von mindestens 1,5 Mio. kWh muss eine Ausspeiseleistung von 500 kW pro Jahr überschritten werden. Die Gasverbräuche werden von dem RLM-Zähler dann stündlich aufgenommen. Die Lastganganalyse ermöglicht es, den Strom- und Gasverbrauch über das Jahr detailliert zu analysieren, zu strukturieren und zu visualisieren. Häufig können so lukrative Einsparpotenziale aufgedeckt werden.
Umsetzung
Der jährliche Strom- und Gasverbrauch ist in der Regel als Jahresverbrauch auf der Dezember-Abrechnung vermerkt. Übersteigt dieser die genannten Grenzen, kann der Lastgang der vergangenen Jahre beim Energieversorger unter Angabe der Vertrags- und Marktlokation angefragt oder über ein Kundenportal abgerufen werden. Der Lastgang wird in den meisten Fällen als csv-Datei zur Verfügung gestellt.
Danach kann er optional über Excel oder eine andere Analysedatei ausgewertet werden. Durch die Analyse eines Lastgangs können Muster, Spitzen und Schwankungen erkannt werden. Analysiert werden beispielsweise das generelle Lastprofil, absolute Lastspitzen, Grundlasten, Unterschiede im Verbrauch einzelner Wochentage sowie typische Zeiten, zu denen hohe Lastspitzen anfallen. Abweichungen, die sich nicht durch die alltägliche System- und Anlagennutzung erklären lassen, bieten Ansatzpunkte, um den Energieverbrauch zu optimieren. Für Betriebe, die keine Messungen an einzelnen Maschinen oder Unterverteilungen haben, ist es sinnvoll, mit Zeitfenstern zu beginnen, in denen Schlussfolgerungen auf einzelne Verbraucher gezogen werden können.
Die Betriebsdaten zeigen, wann welche Maschinen gelaufen sind und können helfen, bestimmte Spitzen oder höhere Verbräuche den einzelnen Maschinen zuzuordnen. Außerhalb der Betriebszeiten können mit Tests sogar die genauen Standby-Verluste erfasst werden, indem einzelne Maschinen aus- und angeschaltet werden. Dazu sollten die genauen Zeiten notiert und jeder Zustand immer mindestens für 15 Minuten aufrechterhalten werden, da der Lastgang des Netzbetreibers nicht detaillierter ist. Für detaillierte Daten empfiehlt es sich, mobile Messungen durchzuführen, weitere Zählertechnik zu verbauen und schlussletztlich ein Energiemonitoring einzuführen. Wirtschaftlich ist es ebenfalls von Interesse, sich mit den höchsten Lastspitzen im Betrieb auseinanderzusetzen. Die höchste absolute Lastspitze in einem Jahr verursacht einen großen Anteil der Netzentgelte. Jeder Netzbetreiber gibt hier einen eigenen Preis pro Kilowatt vor, der für die Ermittlung der Kosten mit der höchsten Spitze multipliziert wird. Hohe Spitzen können mithilfe organisatorischer oder technischer Maßnahmen gesenkt werden, zum Beispiel durch ein Spitzenlastmanagement
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Oft fehlen in Betrieben die notwendigen Software-Kenntnisse für eine zielgerichtete Analyse. Außerdem sind die personellen Kapazitäten mitunter knapp, sodass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Analysen in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Das nötige Fachwissen kann durch gezielte Schulungen für Mitarbeitende aufgebaut werden. Alternativ können auch Dienstleistungsunternehmen beauftragt werden, die Lastganganalysen anbieten und kurzfristig aushelfen können.
Praxisbeispiel
Analyse eines Lastgangs zur Ermittlung von Potenziale
In einem verarbeitenden Unternehmen mit mehreren gleichartigen Standorten wird eine Lastganganalyse durchgeführt, um den Stromverbrauch zu analysieren. Dabei wird festgestellt, dass die Grundlast eines Standortes in der ersten Jahreshälfte gegenüber vergleichbaren Standorten höher liegt. Das zeigt sich vor allem an produktionsfreien Tagen, wenn weniger Störfaktoren Einfluss auf den Verbrauch nehmen.
Als Ursache werden zwei stromgeführte Radiatoren (je 30 kW) identifiziert, die in einem nicht isolierten Raum den Frostschutz sicherstellen sollen. Diese Heizungen sind nicht regelbar und werden dauerhaft mit 100 Prozent Leistung betrieben. Außerdem ist der Temperatursensor nicht optimal positioniert. Durch die Abschaltung einer Heizung und die Neuausrichtung des Temperatursensors können bereits 11.078 kWh/ a eingespart werden, was eine Kostenersparnis von 2.437 € ausmacht. Eine darauffolgende Lastganganalyse am Jahresende zeigt, dass durch die Maßnahme auch die absolute Spitze und somit die jährlichen Netzentgelte gesunken sind.
| Unternehmensgröße | groß |
| Investitionssumme | keine |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 11.078 kWh/ a |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | - |
| CO2-Einsparung/ a | 4,65 t CO2/ a |
| Kosteneinsparung | 2.437 € |
| Amortisationszeit | - |
| Kapitalwert | - |
| Nutzungsdauer | fortlaufend |
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
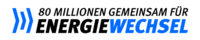
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Ein Standort-Steckbrief ist eines der wichtigsten Instrumente im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Manchmal werden auch die Begriffe Erreichbarkeitsanalyse oder Standortcheck sinngleich verwendet.
Dienstreisen sind wichtig für den Geschäftserfolg und können auch einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß eines Unternehmens leisten.
Elektromobilität im Fuhrpark als Handlungsfeld des betrieblichen Mobilitätsmanagements hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen.
Die Fahrradförderung ist ein wichtiges Handlungsfeld im betrieblichen Mobilitätsmanagement mit Vorteilen für die Beschäftigten und für Arbeitgeber in Bezug auf Kosten, Gesundheit und Zufriedenheit.
Durch ein Mobilitätsbudget werden umweltfreundliche Fortbewegungsmittel attraktiver und der CO2-Ausstoß kann reduziert werden.
Die Förderung der ÖPNV-Nutzung im Betrieb birgt oftmals Potentiale zur Reduzierung von Alleinfahrten und Emissionen auf dem Arbeitsweg.
