Hocheffizienz-Elektro-Motoren als Ersatz für ältere Antriebe
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
0-9 / 10-19 / 20-249 / 250-499 / 500-999
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
Investitionskosten für den Ersatz älterer Elektromotoren durch hocheffiziente Motoren können sich daher bereits nach wenigen Jahren amortisieren.
Einordnung
Elektrische Antriebe sind in produzierenden Betrieben vielfach vorhanden. Häufig sind sie von außen nicht sichtbar, sondern in Geräten und Anlagen wie Pumpen, Lüftern, Ventilatoren, Kompressoren, Fördereinrichtungen und größeren Maschinen integriert. Der Betrieb von Elektromotoren ist für rund zwei Drittel des industriellen Stromverbrauchs verantwortlich, wovon etwa 80 Prozent durch Drehstrom-Asynchronmotoren verursacht werden. Mit rund 95 Prozent der Lebenszykluskosten stellt der Stromverbrauch bei älteren Elektromotoren einen beachtlichen Kostenpunkt dar (Plötz & Eichhammer 2011).
Alte Elektromotoren sind meist überdimensioniert, laufen im Betrieb mit ineffizienten Drehzahlen oder werden mittels Getriebe durch Übersetzungen in Drehzahl und Drehmoment an die Last-Anforderungen angepasst. Insbesondere in Getrieben und im Teillastbereich entstehen neben der geringen Energieeffizienz dieser Motoren weitere Verluste. Moderne Elektromotoren lassen sich mithilfe von integrierten Regelungen elektronisch stufenlos in Drehzahl und Drehmoment an die geforderte Last anpassen. Zudem reduzieren energieeffiziente Motoren durch verbessertes Design, geeignetere Materialien, engere Toleranzen und verbesserte Fertigungstechniken die auftretenden Energieverluste.
Seit 2009 ist die Energieeffizienz von Niederspannungs-Drehstrommotoren im Leistungsbereich von 0,75 Kilowatt (kW) bis 375 kW weltweit normiert. Aktuell werden Motoren in fünf Wirkungsgradklassen von IE1 (Standard Efficiency) bis IE5 (Ultra Premium Efficiency) unterteilt. Seit 2021 dürfen laut der geltenden europäischen Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/1781 für Leistungen ab 0,75 kW nur noch Elektromotoren der Effizienzklassen IE3 bis IE5 in Verkehr gebracht werden. Zwar sind hocheffiziente Elektromotoren der Klassen IE4 und IE5 im Vergleich zu weniger effizienten Modellen derselben Leistung in der Anschaffung oft um ein Vielfaches teurer, jedoch zahlt sich die Investition aufgrund des Verhältnisses von 95 Prozent Betriebskosten zu 5 Prozent Investitionskosten schnell aus. Je länger die jährlichen Betriebszeiten der Motoren sind, desto eher lohnt sich der Ersatz älterer Motoren durch hocheffiziente Motoren.
Umsetzung
Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme aller im Betrieb eingesetzten größeren Motoren mit Leistungen ab circa ein kW durchgeführt werden. Dabei sind Baujahr, Typ und Nennleistung der Motoren jeweils zu dokumentieren. Falls die Möglichkeit besteht, sollte auch die tatsächliche Motorlast bestimmt werden, um die Motorauslastung abschätzen zu können. Bei größeren Motoren kann die Wirkleistung von der Nennleistung abweichen, sodass beide Größen erfasst werden sollten. Falls der Wirkungsgrad der Motoren nicht bekannt ist, kann er anhand der erfassten Größen im Nenn- oder Teillastbetrieb mithilfe von Herstellertabellen abgeschätzt werden. Sofern die Jahresbetriebsdauer der Motoren nicht bekannt ist, sollte auch diese abgeschätzt werden, beginnend mit den größten Motoren. Dazu empfiehlt es sich, die Einsatzdauern während einer typischen Produktionswoche zu dokumentieren und so unter Berücksichtigung von voraussehbaren saisonalen Schwankungen auf ein gesamtes Jahr zu projizieren.
Für die meisten Anlagen oder Maschinen ist ein Ersatz durch IE4-Motoren problemlos möglich, wobei der eventuell größere Platzbedarf berücksichtigt werden muss. Gegebenenfalls kann bei einer Abweichung von Nennleistung und auftretender Spitzenlast auch auf einen Motor kleinerer Leistung zurückgegriffen werden. Für die jeweilige Anwendung ist die Möglichkeit des Einsatzes von IE5-Motoren zu prüfen, bei Bedarf in Verbindung mit einem Frequenzumrichter. Anhand der Betriebsstunden kann der jeweilige jährliche Energiebedarf abgeschätzt werden und die potenzielle jährliche Energie- und Kostenersparnis mithilfe der Wirkungsgraddifferenz zwischen alten und hocheffizienten Motoren der Klassen IE4 oder IE5 berechnet werden.
Auf Grundlage der jährlichen Ersparnisse bei Einsatz hocheffizienter Motoren kann unter Berücksichtigung der notwendigen Investitionen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen. Bei typischen Betriebsdauern ab ca. 2.000 h/ a (8 h/ Tag bei 5-Tage-Woche) kann sich der Ersatz von Motoren innerhalb weniger Jahre rentieren. Dabei sind zwei Investitionsfälle zu unterscheiden:
Bei einer anstehenden, erforderlichen Reinvestition für den E-Motor ist die Differenz-Investitionssumme zwischen der hocheffizienten Lösung und der ohnehin erforderlichen Reinvestition ausschlaggebend. Der zweite Investitionsfall betrifft eine frühzeitige Reinvestition, die nicht zwingend notwendig ist, da der aktuelle Motor noch funktionstüchtig ist. Hier sollte die volle Investitionssumme veranschlagt werden. Wurden die Anforderungen an neue Elektromotoren (Leistungsparameter, Effizienzklasse, Betriebsbedingungen, Baugröße) festgelegt, können passende Angebote von verschiedenen Lieferanten und Herstellern eingeholt werden. Anschließend muss abhängig von vorhandenen Fachkenntnissen in der Belegschaft die Entscheidung über Eigen- oder Fremdmontage getroffen werden. Liefer- und Einbautermine sollten frühzeitig geplant und nach Möglichkeit so eingerichtet werden, dass der Einbau zu ohnehin geplanten Produktionsunterbrechungen stattfindet. So werden Ausfälle minimiert. Nach Einbau sollte genügend Zeit für Einweisungen, Betriebstests und Sicherheitsvorkehrungen eingeplant werden. Ausgebaute Motoren sollten einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Hocheffiziente Elektro-Motoren besitzen in der Regel etwas größere Außenmaße als ältere Motoren gleicher Leistung. Die Baugröße kann insbesondere beim Ersatz von integrierten Motoren in Maschinen sowie in engen Anlagen zu Platzproblemen führen. Häufig sind ältere Motoren aber auch überdimensioniert, sodass die Leistung womöglich reduziert werden kann und kleinere Motoren eventuell durch den Einsatz eines Frequenzumrichters auf das geforderte Drehmoment eingestellt werden können. Befinden sich noch Ersatzmotoren mit geringer Energieeffizienzklasse auf Lager, sind Betriebe vielfach geneigt, eher diese bei Ausfällen zu verwenden, als auf ein hocheffizientes Modell umzusteigen. In diesem Fall lohnt sich eine genaue Berechnung der Lebenszykluskosten, da bei Ersatz durch ein modernes, hocheffizientes Modell nicht nur die Betriebs- und Wartungskosten geringer ausfallen, sondern auch mit einer insgesamt höheren Lebensdauer gerechnet werden kann.
Fördermöglichkeiten
Für Investitionen in energieeffiziente elektrische Motoren und Antriebe zwischen 2.000 € und 200.000 € besteht die Möglichkeit einer Förderung von bis zu 40 Prozent für KMU und bis zu 30 Prozent für große Unternehmen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen der Bundesförderung für Energie-und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft in Modul 1 (Querschnittstechnologien).
Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen
Andere Effizienzmaßnahmen auf der Lastseite der Elektromotoren, beispielsweise effizientere Druckluftpistolen, leichtere Fördertechniksysteme oder ein verringerter Kältebedarf durch bessere Isolation, können die Effizienzgewinne durch den Austausch von Antriebsmotoren reduzieren. Unabhängig vom Ersatz von ungeregelten Motoren durch energieeffizientere Modelle sollten auch Möglichkeiten zur weiteren Prozessoptimierung geprüft werden. Zum Beispiel kann auch der Einsatz von Frequenzumrichtern oder eine bedarfsgerechte Steuerung die Energieeffizienz steigern. Co-Benefits Indem beim Ersatz größerer (und/oder vieler) Elektro-Motoren die maximal bezogene Leistung reduziert wird, können eventuell weitere Kosten durch geringere Leistungspreise beim Strombezug gespart werden. Moderne Motoren weisen zudem eine höhere Lebensdauer und geringere Wartungsintervalle auf als ältere Motoren. Bei durchgängigem Einsatz hocheffizienter Elektro-Motoren führen deren geringere Energieverluste im Sommer zu weniger hohen Temperaturen in den Produktionshallen sowie zu einem geringeren Kühlbedarf in Reinräumen oder anderen klimatisierten Räumen.
Praxisbeispiel
Austausch eines älteren Kompressors mit Motor der Klasse IE1 durch einen hocheffizienten Kompressor mit IE4-Moto
Bei einem mittelständischen Automobilzulieferer wird ein elektrisch angetriebener Kompressor mit einem Motor der Klasse IE1 mit 30 kW durch ein Modell der Klasse IE4 ausgetauscht. Der Kompressor wird wöchentlich im Durchschnitt 40 Stunden auf Volllast betrieben. Durch den Austausch des Kompressors verbessert sich der Motorwirkungsgrad von etwa 91 auf etwa 95 Prozent. Dadurch ergibt sich eine Stromeinsparung von etwa 2.770 kWh pro Jahr, verbunden mit einer jährlichen Kosteneinsparung von 884 €, die zu einer Amortisation der Investition in weniger als sechs Jahren führt. Der Austausch von leistungsstärkeren Motoren bietet dabei ein höheres Einsparpotenzial als der von kleineren Motoren. Dies gilt ebenso für den Austausch von Motoren im Dauerbetrieb im Vergleich zu Einsatzfällen mit vergleichsweise geringen Volllaststundenzahlen.
| Unternehmensgröße | KMU |
| Investitionssumme | 5.100 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 2.770 kWh |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | - |
| CO2-Einsparung/ a | 1,2 t/ a |
| Kosteneinsparung | 884 €/ a |
| Amortisationszeit | 5,8 Jahre |
| Rentabilität | 830 € Nettobarwert |
| Nutzungsdauer | 10 Jahre |
- Größe: 686 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
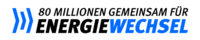
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
