Energieeffizienzmaßnahmen im Schwerlastverkehr
Auf einen Blick
Mobilität
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Gering
Beschreibung
Beispiele sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, der Einsatz von Leichtlaufreifen oder auch eine vorausschauende Fahrweise. Dabei ist oft eine Kraftstoffersparnis von bis zu 10 Prozent möglich.
Einordnung
Der Verkehrssektor in Deutschland ist für 30 Prozent des Endenergieverbrauchs und für 20 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Hierzu trägt insbesondere der Straßenverkehr bei, wo schwere Nutzfahrzeuge etwa ein Viertel des Energieverbrauchs ausmachen, also rund 450 PJ/ a. Im Schwerlastverkehr gibt es vielfältige Ansatzpunkte, um die Energieeffizienz zu steigern und dadurch Kraftstoff einzusparen (UBA 2015). Vergleichsweise schnell und einfach umzusetzende Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Aerodynamik und die Reduzierung des Rollwiderstandes. Auch die Optimierung von Antriebsstrang und Nebenaggregaten, wie Standheizung, Kompressor, Lüfter, Kühleinheiten, Beleuchtung, Kühlwasser-, Öl- und Lenkhilfpumpe, lässt sich kurzfristig umsetzen. Durch die weiter steigende CO2-Abgabe lohnt sich eine Investition in Energieeffizienzmaßnahmen am Fuhrpark zukünftig umso mehr.
Folgende Maßnahmen helfen, Kraftstoff einzusparen:
Umsetzung
Insbesondere im Fernverkehr wird seitens der Fahrzeugbetreiber eine Amortisation zusätzlicher Fahrzeugverbesserungen nach maximal drei bis fünf Jahren angestrebt. Je nach Alter und Jahresfahrleistung eines konkreten Fahrzeugs können die Amortisationserwartungen auch deutlich kürzer sein.
Aerodynamik
Abhängig von Größe und Einsatz eines Lkw macht der Luftwiderstand einen großen Anteil des Kraftstoffverbrauchs aus (siehe Abbildung 1). Zur Verringerung des Luftwiderstandes eines Lkw sollte zunächst sichergestellt werden, dass der Dachspoiler auf der Zugmaschine die richtige Höhe für den Anhänger und die mitgeführte Zuladung hat. Außerdem sollte nach Möglichkeit auf Lkw-Zubehör wie Schutzbügel, Drucklufthörner und Zusatzscheinwerfer verzichtet werden. An der Zugmaschine kann das Anbringen von Luftleitblechen, einer Frontverlängerung, Türsturzverlängerungen, Kotflügelverbreiterungen und Seitenverkleidungen den Kraftstoffverbrauch deutlich senken und entstehende Turbulenzen vermindern. Am Anhänger beziehungsweise Auflieger können zusätzlich eine Seiten- und Unterbodenverkleidung sowie ein Heckeinzug installiert werden. Allein durch diese drei Maßnahmen kann der Widerstandsbeiwert um bis zu 18 Prozent gesenkt werden (UBA 2015).
Rollwiderstand
Der Rollwiderstand der Reifen macht bei Sattelzügen und Transportern im Verteilverkehr ebenfalls einen großen Anteil am Kraftstoffverbrauch aus. Daher sollte der korrekte Reifendruck mehrmals im Monat überprüft werden, bei wechselndem Ladegewicht noch häufiger. Zudem sollte geprüft werden, ob zum Befüllen der Reifen im Betrieb eine Reifenfüllstation eingesetzt werden kann. Ein um 1,5 bar zu niedriger Reifendruck führt zu rund 1 Prozent erhöhtem Kraftstoffverbrauch, da der Rollwiderstand bei unzureichendem Reifendruck zunimmt. Ein korrekter Reifenruck verringert zudem den Verschleiß der Reifen und erhöht die Fahrsicherheit. Die Mehrkosten für Reifen einer höheren Effizienzklasse (Leichtlaufreifen) bei anstehendem Reifentausch können sich innerhalb eines Jahres amortisieren.
Motor und Antriebsstrang
Des Weiteren sollte eine Wirkungsgradoptimierung des Dieselmotors durch gering-investive Maßnahmen geprüft werden, beispielsweise durch den Einsatz von reibungsarmen Schmiermitteln (Leichtlauföl), variablen Wasser- und Ölpumpen sowie eines variablen Luftkompressors. Dadurch kann der Wirkungsgrad des Motors um etwa einen Prozentpunkt erhöht werden (UBA 2015). Im Antriebsstrang führt der Einsatz von Leichtlauföl in Schalt- und Achsgetrieben zu einer deutlichen Reduktion der Getriebeverluste.
Nebenaggregate
Die Nutzung der Innenraumheizung während Ruhezeiten im Winter kann zu einem deutlich erhöhten Kraftstoffverbrauch führen (je nach Lkw-Typ circa 1,5 – 3 Liter pro Stunde (l/ h) im Leerlauf). Der Einsatz von Standheizungen, die nicht an den Motor gekoppelt sind, sorgt daher für erhebliche Energieeinsparungen und sollte bei Lkw im Fernverkehrseinsatz in jedem Fall geprüft werden. Sie werden oft direkt mit dem Treibstoff des jeweiligen Fahrzeugs betrieben und können entweder die Luft des Innenraumes beheizen (Luftheizgeräte) oder über den Kühlwasserkreislauf des Fahrzeugs in den Heizkreislauf eingebunden sein (Wasserheizgeräte). Der Einsatz von elektrisch zusätzlich angetriebenen Anhängern ermöglicht vor allem bei Kühltransporten eine deutliche Kraftstoffersparnis und die Möglichkeit einer Bremsenergierückgewinnung.
Fahrweise und Routenplanung
Lkw, die im Stadtverkehr eingesetzt werden, sollten über eine Start-/ Stop-Automatik verfügen. Zusätzlich können die Fahrer durch Fahrtrainings für den kraftstoffsparenden Betrieb sensibilisiert werden. Fahrwege und Beladungen werden häufig als Sparmaßnahme von den Speditionen beziehungsweise dem Logistikbereich optimiert. Bei Dauerbaustellen auf Fahrwegen mit typischen Stauzeiten von mehr als 10 bis 15 Minuten sollten alternative Routen geprüft werden, was auch zu Zeitgewinnen führen kann.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
An den Seitenverkleidungen von Sattelzügen kann es beim Beladen zu Anfahrschäden durch Gabelstapler kommen. Um dies zu vermeiden, sollten die Fahrer von Sattelzügen und Staplern entsprechend sensibilisiert werden. Der Einsatz einer motorunabhängigen Standheizung kann dazu führen, dass es wegen des Lufterhitzers eng in der Fahrerkabine wird. Um die regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks zu gewährleisten, sollten genügend Kontrollgeräte vorhanden sein und der Vorgang sollte in regelmäßige Wartungsprozesse integriert werden.
Praxisbeispiel
Vom Motor entkoppelte Standheizung
Fahrerinnen und Fahrer von Lkws müssen nach der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gesetzlich vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeiten einhalten und oft in den Fahrzeugen pausieren oder übernachten. Im Winter laufen in dieser Zeit häufig die Motoren, um Wärme zu erzeugen. Standheizungen, die vom Motor unabhängig funktionieren, können die Fahrerkabine effizienter und gezielter aufwärmen. In einem mittelgroßen Transportunternehmen wird daher ein Lkw probeweise mit einer separaten Standheizung ausgestattet.
Der typische Verbrauch liegt bei 0,5 l/ h im Vergleich zu 2 l/ h Leerlaufverbrauch des Motors. Die Standheizung wird im Schnitt während 25 Wochen im Winter eingesetzt, in denen die Ruhezeiten 18 Stunden pro Woche betragen. Der Einsatz der Standheizung führt zu einer Ersparnis von rund 690 l Diesel pro Jahr. Die Investition amortisiert sich daher in weniger als 3 Jahren.
| Unternehmensgröße | KMU |
| Investitionssumme | 3 000 €/ Jah |
| Energieeinsparung (Diesel)/ a | 6 750 kWh/ a |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 0 |
| CO2-Einsparung/ a | 1,8 t/ a |
| Kosteneinsparung | 1 230 €/ a |
| Amortisationszeit | 2,7 Jahre |
| Rentabilität | 2 900 € Nettobarwert |
| Nutzungsdauer | 7 Jahre |
- Größe: 758 KB
Datum: 12.01.2024
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
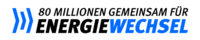
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Ein Standort-Steckbrief ist eines der wichtigsten Instrumente im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Manchmal werden auch die Begriffe Erreichbarkeitsanalyse oder Standortcheck sinngleich verwendet.
Dienstreisen sind wichtig für den Geschäftserfolg und können auch einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß eines Unternehmens leisten.
Elektromobilität im Fuhrpark als Handlungsfeld des betrieblichen Mobilitätsmanagements hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen.
Die Fahrradförderung ist ein wichtiges Handlungsfeld im betrieblichen Mobilitätsmanagement mit Vorteilen für die Beschäftigten und für Arbeitgeber in Bezug auf Kosten, Gesundheit und Zufriedenheit.
Durch ein Mobilitätsbudget werden umweltfreundliche Fortbewegungsmittel attraktiver und der CO2-Ausstoß kann reduziert werden.
Die Förderung der ÖPNV-Nutzung im Betrieb birgt oftmals Potentiale zur Reduzierung von Alleinfahrten und Emissionen auf dem Arbeitsweg.
