Austausch von Überdruck-Sicherheitsventilen sowie Abblas- und Ablass-Ventilen an Druckbehältern
Auf einen Blick
Energieeffizienz
Industrie
0-9 / 10-19 / 20-249
Bundesweit
Kurzfristig (bis 2 Monate)
Beschreibung
Druckbehälter besitzen in ihren verschiedenen Anwendungsformen und Funktionen entweder ein Überdruck-Sicherheitsventil oder ein Abblas- und/oder Ablassventil. Diese Ventile lassen gasförmige oder flüssige Stoffe aus dem Druckbehälter ab und sollten stets voll funktionsfähig sein: Das ist nicht nur aus Sicherheits- und produktionstechnischen Gründen wichtig, sondern auch für die Energieeffizienz. Daher sollten die Ventile regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Einordnung
Druckbehälter können als Speicher zur Pufferung von erzeugter Druckluft, die kurzfristig nicht benötigt wird, eingesetzt werden. Sie können auch als Autoklaven, in denen Reaktionen unter erhöhtem Druck durchgeführt werden, dienen. Die Drücke können typischerweise bis 60 bar und die Temperaturen bis etwa 300 °C betragen. Zudem werden Druckbehälter als Druckflüssigkeitsspeicher verwendet, die Flüssigkeitsvolumen unter Druck aufnehmen. Das kann unter anderem ein Flüssiggas-Tank oder ein Hydrauliköl-Speicher sein, um hydrostatische Energie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Die Speicher können Energie über lange Zeiträume nahezu verlustfrei vorhalten. Die Energieabgabe kann äußerst schnell erfolgen.
Auch Dampfsysteme können als Druckspeicher verstanden werden. All diese Druckbehälter besitzen Überdruck-Sicherheitsventile und Ablassventile. Überdruck-Sicherheitsventile öffnen automatisch bei einem maximalen Druck und schützen den Behälter davor, bei unzulässigem Überdruck zu bersten. Besonders sicherheitsrelevant sind diese Ventile für Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten, um eine Explosion im Brandfall zu verhindern. Ablass-Ventile dienen der kontrollierten Ausschleusung von flüssigen Produkten oder Abfallstoffen aus dem Behälter. Abblas-Ventile schleusen gasförmige Produkte kontrolliert aus. Unnötiger Energieverbrauch entsteht im Betrieb durch alte, nicht genutzte oder auch verunreinigte Ventile. Dies kann durch kleine Leckagen, Korrosion und Verkrustungen auch zu Funktionsbeeinträchtigungen führen. Letztere sind durch das Ausschleusen von Kondensat oder Produkten insbesondere für Ablass-Ventile typisch. Zu hohe Drücke treten auf, wenn Abblas- oder Ablass-Ventile zu spät geöffnet werden. Dies kann unnötig viel Druckenergie oder, bei Autoklaven, Wärmezufuhr erfordern. Der Austausch von defekten Ventilen, führt zu einem geringeren Energiebedarf.
Umsetzung
Zunächst muss sich der Produktionsbetrieb über die im Einsatz befindlichen Druckbehälter und die entsprechenden Ventile einen Überblick verschaffen. Erfasst werden sollten:
- Die Art des Ventils (zum Beispiel Sicherheits-, Druckausgleich-, oder Vakuum-Ventile; Spund-Ventile mit offener und geschlossener Ausführung)
- Arbeitsdruck(-Bereich) und maximaler Druck,
- Die Methode zur Identifikation von Leckagen oder Fehlfunktionen des Ventils (etwa zu hohe oder zu geringe Abflussraten),
- geplante Wartungs- und Austausch-Intervalle.
Messungen zur Identifikation von Druckverlusten oder Fehlfunktionen der Ventile können spontan oder in einem geplanten Zyklus, etwa zum Wartungszeitpunkt, erfolgen. Gasförmige Verluste an den Abblasventilen können durch Ultraschall-Geräte oder, bei höheren Temperaturen, durch Infrarot-Messgeräte identifiziert werden. Bei Ablass-Ventilen werden unerwünschte Verluste durch Schauglasstrecken, Ultraschall oder unerwartet hohe Temperaturen in der Nähe des Ventils entdeckt. Je wahrscheinlicher eine Leckage oder ein Fehlverhalten des Ventils erfahrungsgemäß ist, desto häufiger sollte dieses geprüft werden. Es kann schwierig sein, zu ermitteln, wie viel Energie oder auch Produktionsverluste durch den Tausch von defekten Ventilen eingespart werden können. Denn für die quantitative Bewertung des Verlustes von Gasen, Druckluft, Kondensat oder Produkten sind Messwerte (zum Beispiel Menge des Verlustes pro Stunde, Zeit bis zur Entdeckung des Fehlers am Ventil) erforderlich. Diese sind jedoch häufig nicht hinreichend verfügbar. Deshalb werden die Energieverluste, die durch den Ventiltausch vermieden werden, oft in Schätzwerten angegeben. Um den Gas-, Dampf- oder Flüssigkeitsverlust quantitativ messen zu können, muss der Druckbehälter kurzfristig vom übrigen Produktionssystem getrennt werden. Wie lange eine Leckage unentdeckt vorhanden war, kann unter Berücksichtigung des Zeitpunktes der letzten Wartung oder des letzten Ventiltausches geschätzt werden. Verlustmesswert und unentdeckter Zeitraum bilden dann die Entscheidungsgrundlage, wann das defekte Ventil ausgetauscht werden soll.
Erste Schritte bei der Umsetzung
Herausforderungen und Lösungsansätze
Um das Ventil auszutauschen, muss der Druckbehälter eine Zeitlang außer Betrieb genommen werden. Dies kann den Produktionsstopp der betroffenen Produktionslinie erfordern. Hier sollte abgewogen werden, ob die Energieverluste für eine begrenzte Zeit in Kauf genommen werden. Da die Kosten für den Ventiltausch meist gering sind, ist es sinnvoll, ein defektes Ventil schnell auszutauschen. Den Erneuerungszyklus von Ventilen zu verkürzen minimiert zudem Produktionsstillstände.
Co-Benefits
Ein gleichbleibender Druck in Produktionsapparaten, zum Beispiel Autoklaven, ist oft Voraussetzung für eine konstante Produktqualität. Ein präzise funktionierendes Ventil sorgt für die gewünschte Ausschleusung von Nebenprodukten, etwa CO2 bei Gärprozessen. Hier gewährleistet das Spundventil bei der Lagerung des Produkts die konstant benötigte CO2-Sättigung und sichert so eine gleichbleibende Produktqualität.
Praxisbeispiel
Regelmäßiger Austausch von Ventilen an Druckluftspeichern
Ein kleineres Unternehmen wechselt alle zwei Jahre im Rahmen der üblichen Wartung des 7 Bar-Druckluft-Systems die Sicherheitsventile der Druckluftspeicher. Damit soll das Risiko von undichten Stellen an frei abblasenden Sicherheitsventilen minimiert werden. Die Produktion läuft in zweieinhalb Schichten, die Druckluftanlage wird nur an Wochenenden abgestellt (5.960 Betriebsstunden pro Jahr). Etwa ein Jahr nach dem letzten Ventiltausch entdecken die betrieblichen Energie-Scouts mit einem Ultraschallgerät ein undichtes Sicherheitsventil an einem der Druckluftspeicher. Die Leckage ist mit 7.150 Nm3 pro Jahr vergleichsweise klein. Da das Sicherheitsventil (zwischen 0,2 und 25 bar einstellbar) im Handel für 45 € erhältlich ist und die Arbeitskosten für den Tausch weniger als 55 € betragen, wechselt der Betrieb die Sicherheitsventile von nun an jährlich. Die Wahrscheinlichkeit wird als hoch eingeschätzt, dass bereits in den ersten acht Monaten nach Ventiltausch eine kleine Leckage entsteht.
| Unternehmensgröße | klein |
| Investitionssumme | Unter 100 € |
| Energieeinsparung (Strom)/ a | 900 kWh |
| Energieeinsparung (Gas)/ a | 0 |
| CO2-Einsparung/ a | 0,38 t |
| Kosteneinsparung | 320 €/ a |
| Amortisationszeit | 0,3 Jahre |
| Rentabilität | 196 € Nettobarwert |
| Nutzungsdauer | 1 Jahre |
Quellenangabe
Partner
Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke
Die Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeinsparung und Energiesubstitution werden von der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke publiziert. Seit 2014 unterstützt die Netzwerkinitiative Unternehmen dabei, sich in Netzwerken auszutauschen. Die Initiative wird von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Dieses Factsheet entstand in Kooperation mit der Limón GmbH und IRESS GmbH - Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien.Website öffnen
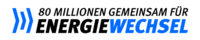
Energiewechsel-Kampagne des BMWK
Ziel der Energiewechsel-Kampagne des BMWK ist es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern, über Verbände und Unternehmen, bis hin zu den Kommunen.Website öffnen
Datum
Zuletzt geändert am 12. Januar 2024Verwandte Artikel
Dienstreisen sind wichtig für den Geschäftserfolg und können auch einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß eines Unternehmens leisten.
Elektromobilität im Fuhrpark als Handlungsfeld des betrieblichen Mobilitätsmanagements hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen.
Die Fahrradförderung ist ein wichtiges Handlungsfeld im betrieblichen Mobilitätsmanagement mit Vorteilen für die Beschäftigten und für Arbeitgeber in Bezug auf Kosten, Gesundheit und Zufriedenheit.
Durch ein Mobilitätsbudget werden umweltfreundliche Fortbewegungsmittel attraktiver und der CO2-Ausstoß kann reduziert werden.
Die Förderung der ÖPNV-Nutzung im Betrieb birgt oftmals Potentiale zur Reduzierung von Alleinfahrten und Emissionen auf dem Arbeitsweg.
Ein Standort-Steckbrief ist eines der wichtigsten Instrumente im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Manchmal werden auch die Begriffe Erreichbarkeitsanalyse oder Standortcheck sinngleich verwendet.
